von Susanne Scharnbeck
Der Spiegel leuchtete im Abenddunkel. Schwere Ziffern blitzten unter dem letzten Rot des Himmels, verfolgt von den goldenen Zeigern des alten Regulators, der drohend in der Ecke schwang. Neugierig schaute ich mich um. Das Zimmer war mir bekannt, ich wusste, dass ich es vor langer Zeit schon einmal betreten hatte. Doch wozu und bei welcher Gelegenheit? Ein kissenverzierter Schaukelstuhl stak nahe dem Fenster, gesäumt von einer Blumenbank. Blaue Vorhänge wehten leicht im Windzug, der aus dem schmalen Spalt des angelehnten Fensterrahmens hereinschwebte. Hatte ich hier bereits gesessen? Natürlich, es war mit Gabriel, Gabriel, der Kluge, der Schöne.
Braune Lederschuhe fand ich, sorgfältig in einer Ecke abgestellt. War er hier? Mein Herz begann zu springen und die Apfelblüten in der weißen Vase erzitterten mit kühlem Blütenschauer. Ein luftiges Muster schrieben sie auf der polierten, honigfarbig gemaserten Platte der auf gedrechselten Füßen stehenden Anrichte. Es hatte die Form einer Sieben. Nicht lange, denn meine Hand fuhr hinein, um mit den zarten Blütenblättern zu spielen. Da bebte die weiße Wand hinter dem Möbelstück und verschwamm vor meinen Augen. Hilfesuchend streckte ich den Arm aus und bemerkte, wie dieser durch den rauen Putz hindurchfuhr. Erschrocken zog ich ihn zurück, nur um ihn sofort wieder auszustrecken. Wasser. Die Wand fühlte sich wie Wasser an. Ich folgte mit meinem Körper und blieb sofort auf der anderen Seite der Zimmerwand verwundert stehen.
Eine grüne Wiese wellte sich bis zum Horizont und darüber hinaus. Das burgunderfarbene Dach eines Hauses lugte dahinter hervor. Nach einigen Schritten öffnete sich der Blick auf die andere Seite des Hügels und eine weiß gestrichene Fensterfront mit azurblauem Türrahmen zeigte sich, von einem ebenso weißen Zaun umgeben. Ein kleines blondes Mädchen, allerhöchstens vier Jahre alt, pflückte auf der Wiese vor dem Haus Gänseblümchen. Als sie mich sah, sprang sie auf und rannte auf mich zu: “Mama! Mama!”, streckte mir die kleine, schmutzverschmierte Hand mit den geknickten Blüten hin. War ich hier zu Hause? Ja, ganz sicher war ich das. Hier war mir alles so vertraut.
Ich drückte die Kleine und ging mit ihr in das Haus, um den Gänseblümchen eine letzte Gnadenfrist im Schnapsglas zu gewähren und dem Dreckspatz die Hände zu waschen. Ein Mann, mein Mann, saß in der Ecke und werkelte an einem Regal. Seine Augen leuchteten freudig auf, als er mich sah, sofort ließ er das Werkzeug fallen um aufzustehen und mir einen Kuss zu geben. “Wo hast du so lange gesteckt?”, fragte er lachend. Ich antwortete ausweichend und sah in die Küche, sauber, gemütlich, hell – die Tür zum Garten stand noch immer offen und die Kleine war schon wieder draußen und pflückte die letzten Erdbeeren von den niedrigen Rabatten. “Lass uns Abendessen machen, Gabriel!”, sagte ich und er nickte, umschlang meine Taille, mich zu sich heranziehend. Der nächste Kuss dauerte länger und wurde durch den spitzen Schrei von Lilja unterbrochen. Gleichzeitig liefen wir hinaus und mit ekelverzogenem Gesicht zeigte sie uns einen fetten Regenwurm, der sich unter einer der Pflanzen wand. “Der ist pfui!”, rief sie und sprang mit ihren Schühchen auf dem Wurm herum, bis er sich nicht mehr wand und still da lag.
“Lilja!”, griff Gabriel vorwurfsvoll ein, “der tut doch niemandem was und ist kein Grund hier so rumzuschreien.”
“Aber er ist hässlich!” Lilja blieb unerbittlich.
Mit vereinten Kräften zogen wir die Regenwurmtöterin in das Haus, wo es nun endlich das Abendessen geben würde. Gabriel steckte sie unter Gequengel in die Badewanne, während ich die Radieschen putzte, deren scharfer Duft an meinen Fingern kleben blieb. Gedankenverloren schaute ich dabei über die Streben des kleinen Fensters und den Margaritenbusch hinweg in den Garten. Da zog ein eigenartiges Gebilde meine Aufmerksamkeit auf sich. Es war die Lücke in einer Hecke und sie hatte die Form einer Sieben. Flüchtig an irgendetwas erinnert, ließ ich das Messer fallen und wandelte wie magnetisiert zur Tür hinaus, geradewegs auf die Hecke zu. In der kahlen Stelle waren Zweige geknickt. Ich bog sie auseinander, immer weiter, denn dahinter schien etwas auf mich zu warten. Mein Puls beschleunigte sich und ich fühlte ein furchtsames, aber dennoch angenehmes Kribbeln. Mit einem beherzten Satz durchschritt ich die Hecke und fand mich auf einer sanft gewellten grünen Wiese wieder. Ja klar, was hatte ich denn erwartet? Doch als ich mich umschaute war die Hecke verschwunden und eine Stadt breitete sich stattdessen in einer weiten Talmulde aus. Erstaunt verharrte ich einen Moment, dann wählte ich den rosa gepflasterten Weg, der direkt in das Tal hineinführte. Dabei spürte ich eine ausgelassene Abenteuerlust, so als sei das alles gar nicht wirklich. Wohin würde mich der Weg bringen? Wem würde ich begegnen?
Etwa zwei Kilometer war ich wohl gegangen, als ich eine Alte mit einem kleinen, blonden Mädchen traf. Natürlich, es war Lilja! Freudig rief ich nach ihr und lief auf sie zu, aber sie schaute mich verständnislos an und klammerte sich an den Rock ihrer Begleiterin.
“Lilja, was ist? Kennst du mich nicht mehr?”
“Lassen Sie das Kind in Ruhe! Sie heißt nicht Lilja”, mischte sich die Alte ein.
“Aber…, das kann nicht sein. Sie ist es doch!”
Verwirrt schaute ich den beiden nach, die sich eilig entfernten und ab und zu verstohlene Blicke zu mir zurück warfen. Ich fühlte mich wie vom Schlag getroffen. Eine dumpfe Wolke brütete in meinen Schädel und hinter meinen Augen. Es dauerte eine Weile, bis ich mich gesammelt hatte und weiterschritt. Ich musste unbedingt Gabriel finden. Er sollte mir erklären, was geschehen war. Doch wo konnte ich ihn suchen, das Haus gab es ja nicht mehr. Ich beschloss, weiter dem rosafarbenen Weg zu folgen und in der Stadt zu fragen.
Es müssen noch einmal zwei Kilometer gewesen sein, bis ich in die erste bebaute Straße einbog. Einige Leute waren unterwegs. Ich fragte sie nach einem Mann namens Gabriel, doch sie schüttelten den Kopf. Plötzlich wurde mir bewusst, dass ich absolut nicht wusste, was ich hier machte und wohin ich gehörte. Ich durchquerte weitere Straßen,
kopfsteingepflastert und von alten zweistöckigen Häusern gesäumt, altertümliche Laternen in einigen Abständen, als ich jemanden rufen hörte.
“Hey, Sie! Sie da! Hallo!” – War ich damit gemeint? Ich wandte mich um und tatsächlich kam ein dicker schwitzender Mann auf mich zugeeilt.
“Sie…wohnen Sie nicht dort drüben in der Dachwohnung?” – Ich antwortete nicht, sondern schaute in die Richtung, in die sein Finger zeigte. Unbestimmt zielte er auf ein halb verfallenes Haus, von dessen Wänden der Putz bröckelte. Irgendwoher kannte ich es.
Der Mann wartete meine Antwort nicht mehr ab. Stattdessen schrie er fast mit betonter Wichtigkeit: “Die Polizei war vorhin da und hat die Tür aufgebrochen, weil es so verdächtig stank. Vielleicht bringen Sie Ihre Schweinerei dort mal in Ordnung!”
Verächtlich schnaubend machte er kehrt und ging siegesgewiss von dannen.
Ich wusste nicht was er meinte, aber ich ahnte es. Als ich die kleine Dachwohnung betrat, schlug mir ein fauliger Geruch entgegen. Müllsäcke stapelten sich im Flur, in der Küche gammelten schimmelige Essensreste und von Maden zerfressene Kartoffeln. Das einzige kleine Zimmer war schmutzig und unordentlich. Überall lagen leere Wodka- oder Bierflaschen herum. Hier sollte ich wohnen? Ich spürte Panik in mir aufsteigen. Nicht wegen des Schmutzes, sondern wegen des starken Gefühls, in eine Falle getappt zu sein. Wo war Gabriel? Was war mit Lilja? Mit schreckgeweiteten Augen klopfte ich an die Wohnungstür im Erdgeschoss. Eine ältliche Frau in Kittelschürze öffnete und schaute mich abweisend und ein wenig erschrocken an.
“Entschuldigung, wissen Sie zufällig wo mein Mann ist?”, fragte ich.
“Sie haben doch keinen Mann”, sagte sie ebenso verwirrt wie ärgerlich.
“Aber sicher! Warum sagen Sie so was? Er muss hier irgendwo sein! Sagen Sie mir, wo mein Mann ist!”
Inzwischen schrillte meine Stimme laut durch das Haus und einige Menschen von der Straße schauten verwundert in den Flur hinein. Die Frau schlug mir die Tür vor der Nase zu und völlig aufgelöst schrie ich nun die Leute im Hausflur an:
“Wo ist mein Mann, verdammt noch mal? Ihr wisst es. Ich sehe es euch an.”
Ein beherzter Zuhörer griff nach meinem Arm und führte mich mit hartem Griff die Treppe hinauf in meine Wohnung. Ich hörte, wie hinter mir getuschelt und gelacht wurde.
“Reißen Sie sich endlich zusammen und holen Sie sich Hilfe!”, sagte er noch zu mir, bevor er hinter dem unteren Treppenabsatz verschwand. Hilfe? Denken die etwa ich bin durchgedreht? Dann schaute ich in die Wohnung und da wusste ich – ja, sie denken ich bin durchgedreht und krank. Genau dasselbe dachte ich doch auch, wenn ich das Chaos betrachtete. Wie hatte das geschehen können?
Ich verbarrikadierte mich hinter der Wohnungstür und begann zaghaft, den Dreck zusammenzuräumen. Eigentlich hätte ich den Müll gerne weggebracht, aber ich fürchtete die hämischen und abschätzigen Blicke, die mich treffen würden, wenn ich jemandem begegnete. Also räumte ich noch einen Müllsack mehr in den Flur und wusste nicht mehr weiter. Es musste doch irgendjemanden geben, der zu mir gehörte, der mir helfen könnte. Ich durchwühlte Schränke und Haufen von Gerümpel nach einem Hinweis, fand jedoch nichts. Vollkommen entmutigt griff ich nach einer halbvollen Wodkaflasche und fand mich damit auf dem Fußboden wieder. So hatte es geschehen können. Besinnungslos schloss ich die Augen.
Als ich sie wieder öffnete, nahm ich den Gestank nach Alkohol und fauligem Abfall mit doppelter Intensität wahr. Ich musste diese Wohnung verlassen oder ich würde mich mit absoluter Sicherheit zu Tode saufen. Nochmals begann ich Kommoden und Schränke nach Hinweisen zu durchsuchen, und tatsächlich, ich fand ein Babyfoto und ein Dokument, aus dem ich erfuhr, dass ich Lilja nach der Geburt zur Adoption freigegeben hatte. Wieso nur? Und was war mit Gabriel? Auf der Geburtsurkunde, die ebenfalls bei den Papieren lag, stand sein Name in verwaschener Schrift, doch sonst war nichts von ihm zu finden.
Ich steckte das Foto und die Papiere ein, dann schlich ich mich vorsichtig und leise aus der Wohnung heraus. Ich hoffte, dass
ich niemandem begegnen würde. Als ich an der Türe im Erdgeschoß vorbeischlich, hörte ich die Frau laut mit ihrem Ehemann sprechen. Lautlos blieb ich stehen.
“Die von oben hat doch tatsächlich heute hier geklingelt und nach ihrem Mann gefragt. Stell dir das mal vor. Dabei hat der sie doch schon vor ich weiß nicht wie vielen Jahren sitzen lassen.”
Der Mann lachte schallend. “Das war doch kurz vor der Geburt des Kindes, oder?”
“Ich glaube schon.” Es sprach erneut die Frau. “Ich verstehe gar nicht, warum die Behörden da nicht eingreifen und irgendwas unternehmen. Die gehört in die Klapse!”
Benommen und taumelnd schlich ich weiter, fast wäre ich über die letzte Treppenstufe gestolpert. Ein gefundenes Fressen – es würde heißen, ich wäre besoffen die Treppe hinuntergefallen.
Erst an der nächsten Straßenecke atmete ich auf, aber die Stiche in meinem Herzen ließen trotzdem nicht nach. Über einer Haustür erkannte ich die Hausnummer 7. Ich glaubte mich zu erinnern und überquerte den schmalen Bürgersteig. Flehend betastete ich die Hauswand, doch es passierte nichts. Rauer Putz staubte an meinen Fingern. Sollte ich mich so geirrt haben? War es nur eine falsche Hoffnung? Es musste doch einen Ausweg geben!
Immer und immer wieder fuhr ich mit der Hand die Hauswand entlang, krallte mich hinein bis die Fingernägel brachen. Endlich lichtete sich das Chaos in meinem Kopf für einen kurzen Moment und ich griff nach der kühlen Klinke der Haustür. Schwer lag das Gewicht der Pforte auf meiner Schulter, sie ließ sich kaum öffnen, aber schließlich trat ich ein. Und ich stand nicht im Hausflur, sondern in einem Schlafzimmer mit rankenden Tapetenblumen. Mit einem Blick zurück vergewisserte ich mich – die Tür hinter mir führte nun in ein Badezimmer. Ich hatte es geschafft. Das Schlafzimmer wirkte etwas düster und hätte eine Renovierung nötig gehabt. Zwei billige Schränke und ein Ehebett standen darin. Kleidung stapelte sich über einem Wäschekorb.
Die gegenüberliegende Tür öffnete sich und Gabriel trat ein. Seine Augen wirkten abwesend.
„Da bist du ja endlich!” Erleichtert sprang ich ihm entgegen. Doch eine unbestimmte Kälte ließ mich zurückprallen. War das Abscheu in seinem Gesicht?
„Fang nicht schon wieder an mir Vorhaltungen zu machen! Du weißt genau, dass ich manchmal länger arbeiten muss.”
„Ähm, ja, ich freue mich eigentlich nur, dass du da bist.”
„Ach hör doch auf!” Die Tür schlug krachend in das Schloss und ich zuckte zusammen. Irgendetwas stimmte hier nicht.
Es schien eine recht kleine Wohnung zu sein, aber mit zahlreichen Zimmern. Seltsamerweise wusste ich genau, was ich hinter welcher Tür finden würde. Gabriel klirrte wütend mit den Tellern. Aus der Küche schrie er: „Warum ist eigentlich noch kein Abendessen fertig?”
Ja, was sollte ich sagen? Ich schwieg. Instinktiv wusste ich, dass dies der falsche Moment war, um mit ihm zu reden. Stattdessen nahm ich ihm die Teller aus der Hand und deckte den Tisch.
Während des Abendessens, das sehr still verlief, hörte man nur die Stimme der Nachrichtensprecherin aus dem Fernsehgerät. Lilja kaute stumm vor sich hin, sie wirkte bedrückt, und für Gabriel schienen wir nicht anwesend zu sein. Er hatte nur Augen und Ohren für das Fernsehprogramm. Ich brachte Lilja zu Bett und setzte mich zu Gabriel in das Wohnzimmer.
„Was ist mit uns geschehen?”, leise verklang die Frage im penetranten Gesäusel eines Werbespots.
Sein Gesicht verzog sich angewidert, er sprang auf und knallte die Tür hinter sich zu. Ich folgte ihm auf dem Fuß. „Sprich doch bitte mit mir! Was ist los mit dir, mit uns?”
Er reagierte nicht, sondern griff demonstrativ nach seiner Jacke und verschwand auf der Straße.
Die Zeit verging unendlich langsam, bis sich endlich die Schlafzimmertür öffnete und ein schmaler Streifen Licht den Fußboden teilte. Schwer ließ sich sein Körper auf der anderen Seite des Bettes nieder und ich konnte spüren, wie sich sein Brustkorb hob und senkte. Vorsichtig schob ich mich zu ihm hinüber und griff nach seiner Hand. Doch sobald er bemerkte, dass ich noch wach war, rollte er sich zur Seite und entzog sich. Ich begriff es nicht. Warum machte er nicht einmal den Versuch, es mir zu erklären? Hatte er eine Geliebte? Kam er deshalb oft spät nach Hause? Lange lag ich wach und die Dunkelheit umgab mich wie ein Sarg.
Auch am nächsten Tag verliefen alle Versuche mit ihm zu reden im Sande. Im Allgemeinen machte er den Eindruck, als nähme er mich und Lilja gar nicht wahr, doch sobald ich einen Vorstoß wagte, ergriff er die Flucht. Ich begriff, dass es keinen Sinn hatte. Doch wie sollte ich so leben? Ich fühlte mich, als wäre ich nicht vorhanden und auch Lilja wirkte so blass und durchsichtig, als würde sie sich jeden Moment in Luft auflösen. Eine kraftlose Wut ergriff mich und ich begann seine Kleidung und persönlichen Sachen nach Hinweisen zu durchwühlen. Ich musste es einfach wissen, musste Gewissheit haben, aber ich fand nichts. Die Fragen in meinem Kopf zerfraßen mein Gehirn, da fiel mein Blick auf den Abreißkalender in der Küche. Heute war der 6. Juli. Sofort riss ich das Blatt in einer wilden Anwandlung ab und die schwarze Sieben erschien vor mir.
Die Wand tat sich auf – ja, genauso hatte ich es erwartet – und ich stolperte. Eine Sonnenliege stand zu meinen Füßen, fast wäre ich über sie gefallen. Ich sah mich um. Ein Swimmingpool glitzerte im Licht der abendlichen Gartenlichter. Kurz tauchte ich meine Hand in das Wasser. Es war angenehm warm. Trotzdem zog es mich in den dunklen Garten. Das Licht reichte gerade noch aus, um zu sehen, wie kunstvoll er angelegt war. Der schwere Duft des Ginsters lag wolkengleich auf den Wegen. Da begann auf einmal eine schrille Plastikmelodie zu lärmen. Sie kam von einer der Sonnenliegen, ich eilte zurück und ich fand ein Handy darauf.
„Ja?” Meine Stimme klang unsicher.
„Hey, was machst du? Ich hoffe, du hast dich auf das Interview morgen vorbereitet. Außerdem wollte ich noch ein paar Fragen zu den Markteinführungswerten mit dir besprechen. Die Sitzung findet erst am frühen Nachmittag statt. Danach hast du genug Zeit, dich auf die Benefizgala vorzubereiten.”
„Wer ist da?”
„Na ich, David.”
Ich hatte keine Ahnung, wer David war.
„Tu mir bitte den Gefallen und rufe in zehn Minuten noch einmal an. Es kommt gerade ein Fax wegen der geplanten Transaktion rein. Vielleicht kannst du mir ja auch schon einen Rohentwurf deiner Rede vor der Aktionärsversammlung per Email schicken.”
Er legte auf und mir wurde äußerst mulmig zumute. Um Himmels Willen! Wo hatte ich mich nur hineinmanövriert!
Nach einigem Suchen fand ich auf der prunkvollen Veranda im Kolonialstil, wie ich sie aus meinen Träumen kannte, ein geöffnetes Laptop. Jemand schien daran gearbeitet zu haben und tatsächlich, eine Datei war geöffnet, welche die fast fertige Rede enthielt. Ok, das war gut. Nur noch ein paar sprachliche Änderungen und Ergänzungen und ich konnte das so nehmen. Außerdem fand ich genug Material auf dem Laptop, das mir helfen würde, mich einzuarbeiten und die wichtigsten Informationen parat zu haben.
Konzentriert wie ich war, bemerkte ich kaum, wie sich eine kleine Hand auf mein Bein legte. „Mama!”
„Was denn Lilja, du bist ja immer noch auf! Solltest du nicht längst im Bett liegen?”
„Ich darf heute länger aufbleiben, hat Papa gesagt.”
„Hm, na schön.” Unruhig wanderte mein Blick bereits wieder in den Zeilen umher.
„Bringst du mich ins Bett und liest mir noch etwas vor?”
„Mama hat noch viel zu tun, der Papa bringt dich in das Bett und ich komme sobald ich kann und lese dir etwas vor. Einverstanden?”
Lilja nickte.
Hinter ihr stand jetzt Gabriel. „Hallo Schatz!”, grüßte er mich, merkwürdig zurückhaltend. Aber das war jetzt nicht wichtig.
Ich hatte während meiner Arbeit ganz die Zeit vergessen und als ich sehr viel später an das Bettchen von Lilja trat, schlief sie bereits fest, mit beiden Händen ein Märchenbuch umklammernd. Sie hatte auf mich gewartet.
Die Nacht war schnell vorbei und ich hatte schlecht geschlafen, im Übrigen alleine, denn Gabriel und ich hatten getrennte Schlafzimmer.
Der Grund war mir ein Rätsel, aber da sein Umgang mit mir sehr förmlich war, vermutete ich einige Diskrepanzen. Na gut, das musste ich ein anderes Mal klären. Heute hatte ich einen Tag voller Termine.
David holte mich schon sehr früh mit dem Wagen ab und die Art, wie er mir seine Lippen auf den Mund presste, ließ mich das Schlimmste befürchten.
„Was ist mit dir?”, fragte er. „Das letzte Mal im Büro warst du noch etwas leidenschaftlicher.” Anscheinend schlief ich mit meinem Geschäftsführer. Jetzt wurde mir einiges klar.
Als ich den Wagen verließ und die Hotelhalle betrat, staunte ich nicht schlecht darüber, wie bekannt ich in der Öffentlichkeit war. Ich wurde sogar nach Autogrammen gefragt. Der Gedanke an das Interview hatte mir einige Sorgen bereitet, aber alles lief völlig glatt. Keine bösen Fallen und keine Fragen, die mich in Verlegenheit brachten. Überhaupt begann mir die Sache Spaß zu machen, denn augenscheinlich war ich sehr wohlhabend, vielleicht sogar Millionärin. Ich hoffte, dass nur der heutige Tag so anstrengend sein würde und ich danach wieder mehr Zeit hätte, um die Vorzüge des reichen Lebens mit meiner Familie zu genießen. Leider war ebenfalls im Terminkalender für die darauf folgenden Tage nicht mehr viel Platz, aber David erklärte mir überzeugend, wie wichtig es sei, diese einzuhalten. Und genau genommen wollte ich das auch, denn die Wichtigkeit meiner Person und die Herausforderung, eine erfolgreiche Unternehmerin zu sein, gefielen mir. Ich musste nur noch die Sache mit Gabriel einrenken, wenn ich irgendwann die Zeit dazu finden würde.
In Gedanken versunken stieg ich in den Fahrstuhl und wurde mir dessen zu spät bewusst, dass auf der Anzeige über dem Fahrstuhl eine rote Sieben leuchtete. Es war nichts mehr zu machen, ich hatte dieses Leben bereits verlassen und fand mich in einer Menschentraube wieder. Hinter mir sah ich Gräber, kleine und große, Bäume beugten sich über sie. Ich war auf einem Friedhof. Die Leute um mich herum trugen Schwarz. Ich fragte mich, wer wohl gerade beerdigt wurde und erhaschte den Blick auf einen auffällig kleinen Sarg.
„Wer ist denn gestorben?”, fragte ich leise und zögernd neben mir in die Runde. Mitleidig wurde ich angeschaut, doch niemand antwortete.
Ich fragte zur anderen Seite und spürte plötzlich, wie mich jemand am Arm griff und nach vorne zog. Die mitleidigen Blicke folgten mir. Es war Gabriel. Er stützte mich und forderte mich wortlos auf, eine Handvoll Sand zu nehmen.
„Wer ist es?”, fragte ich nun mit einer furchtbaren Angst im Herzen.
Er antwortete nicht, schaute mich nur fragend an, und in diesem Moment wusste ich es. „Lilja!”, flüsterte ich und er sah sofort wieder starr geradeaus. Mir war, als müsste ich zusammenbrechen, doch seine Hand stützte mich unnachgiebig und ich ließ es geschehen.
Die nachfolgende Feier glaubte ich kaum zu überstehen. Gabriel war die gesamte Zeit an meiner Seite und das tat gut. Ich fühlte mich getröstet und geborgen, auch wenn es den Schmerz nicht wirklich lindern konnte. Dass er so selbstbeherrscht und abwesend wirkte, störte mich nicht. Ich hielt es für seine Art zu trauern.
Am Abend kümmerte er sich rührend um mich, brachte mir Tee und eine warme Decke, nahm mich in den Arm, wenn ich es brauchte und tat alles, was nur möglich war, damit ich mich besser fühlte.
Er tat es rein mechanisch, als hätte er es vorher bereits einstudiert, doch was hatte ich erwartet. Er war natürlich ebenso wie ich vollkommen mit seiner Trauer beschäftigt und ich war ihm dankbar dafür, dass er trotz allem so viel Selbstbeherrschung behielt und seine Stärke mir zugute kommen ließ.
Weinend war ich eingeschlafen und früh am Morgen erwachte ich von dem höllischen Lärm, den der Sturm machte, der um unser kleines Haus tobte. Nicht weit entfernt wühlte er das Meer zu meterhohen Wellen auf, die krachend an das felsige Ufer schlugen.
Vorsichtig stand ich auf, zog mir etwas über und schlich mich aus dem Haus. Die Haustür wurde mir vom Wind aus der Hand geweht und schlug scheppernd in das Schloss, so dass sich das altvertraute Blumengebinde löste und zu Boden fiel. Ich ließ es liegen und wanderte in Richtung Meer, bis hinaus auf einem der hohen Kreidefelsen, wo es nicht mehr weiterging. Das Meer wütete ungestüm und zornig in seinem Uferbett, wie hypnotisiert starrte ich hinunter. Für eine kurze Nichtzeit kam mir der Gedanke, mich fallen zu lassen, es zu beenden. Ich trat etwas näher an den Rand des Felsens, dorthin, wo der Boden begann, weich und abschüssig zu werden.
Doch nein, ich würde es nicht tun, die Welt würde sich weiterdrehen und auch ich würde weiterleben. Hinter mir bemerkte ich eine Gestalt. Es war Gabriel. Er kam neben mir zu stehen, sein Gesicht unbewegt. Sicher hatte er sich Sorgen gemacht.
Durch meine Drehung war ein großer Brocken Erde und Geröll in Bewegung gekommen und löste sich langsam, wie mir schien, aber nicht langsam genug. Ich strauchelte und griff panisch nach Gabriel, als der Boden unter meinen Füßen nachgab. Auch er griff nach mir, hielt mich für eine kleine Ewigkeit, in welcher sich das Entsetzen in seinen Augen ausbreitete, doch was er dann sagte, das verstand ich nicht. Der Sinn seiner Worte wollte sich mir einfach nicht erschließen.
„Erst habe ich Lilja getötet und jetzt bist du dran!”
Der Kirchturm läutete genau sieben Male, als ich fiel.
Ich wurde von dem lauten Lied einer Amsel geweckt, welche sich die Regenrinne zur Opernbühne erkoren hatte. Sonnenlicht strich durch die Vorhänge und ließ die Staubflöckchen im Zimmer tanzen. Gabriel lag neben mir. Sein Atem ging ruhig und gleichmäßig. Als er erwachte, lächelte er.
„Wir kennen uns heute auf den Tag genau sieben Monate.”
„Ach nein? Wirklich?” Mein Erstaunen war nicht nur gespielt, doch er lachte. Nach einer verspielten Balgerei und einem ausgedehnten Frühstück hieß es Abschied nehmen, wenn auch nicht für lange. Schon am Abend sahen wir uns wieder. Er hatte frische Erdbeeren mitgebracht und sein Mund schmeckte nach eben diesen, als er mich mit seinen weichen Lippen küsste. Der alte Kaminofen, der mir schon an so vielen Herbst- und Winterabenden warme Gesellschaft geleistet hatte, erhellte den kühlen Sommerabend und lange dauerte unsere Umarmung. Gut, hier war es schön, hier wollte ich bleiben, hier war noch alles möglich.
Und wieder war es zu spät.
Ich hatte das Label auf seinem sportiven T-Shirt nicht beachtet. Es zeigte eine Sieben. Kaum hatte ich es berührt, sank ich in ihn hinein, durch ihn hindurch. Ich hatte Gabriel durchquert.
Wieder stand ich im stillen Abenddunkel. Der Schaukelstuhl stak noch immer in der Ecke und die Apfelblüten fingen das Licht des endenden Tages. Auch die Schuhe von Gabriel standen noch da, wie seltsam bekannt mir doch dieses Zimmer war, obwohl es so altertümlich anmutete.
In der Tasche meiner Bluse fand ich ein Foto. Es war leer, nichts darauf als milchiger Nebel. Ein kaum hörbares Geräusch ließ mich innehalten. Es kam von dem großen Spiegel an der Wand. Als ich in seine Richtung schaute nahm ich unbewusst mein Spiegelbild wahr, doch etwas daran erregte meine Aufmerksamkeit. Ich änderte den Fokus und hielt vor Schreck gelähmt mitten in meiner Bewegung inne, spürte einen Schrei aufsteigen, der jedoch in einer stummen Mundbewegung von irrem Entsetzen endete.
Das Spiegelbild dort war nicht ich. Zwei durchdringende graue Augen starrten in mich hinein. Ich kannte sie. Es war Helena Blavatsky, die mich aus dem Spiegel heraus musterte. Nach einem grauen Schleier greifend verhüllte sie ihn nun. Augenblicklich waren nur noch formlose Schemen darin zu erkennen und ihr Gesicht verschwand ebenfalls hinter dem grauen, leeren Vorhang. Sie hatte genug gesehen.
Letzte Einträge
Themen-Thermometer
- André-Preidel Astrid-Hoff Bernd-Mayer Blog Blogosphäre Christian-Lumma Daniel-Thiem Die-Linie-7 Die-sieben-Zwerge-von-G47 Dominik-Opalka Duisburg Flyer Franziska-Ring Hans-Joachim-Heider Info Information Jury Kellapage Kurzgeschichte Kurzgeschichten Lavendel Lyrik-Forum MP3 Nora-Lessing OpenPR PDF Philosophie-Raum Presse Promotion Prospero Remscheid Robin-Haseler Sajonara Sieben Sieben-Himmel Siebenschläfer Teddykrieger teilt-euch-mit-uns Thomas-Zelejewski Turnschuhromantik Uta-Brandschwei Verlag Wettbewerb Wordpress Zu-Risiken-und-Nebenwirkungen

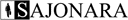
No Comments
Leave a Comment
trackback address
You must log in to post a comment.