von Nora Lessing
Manchmal vergesse ich, wie lange ich schon hier bin. Die Minuten werden zu Stunden und die Stunden zu Tagen, die sich wie Schmirgelpapier durch meine Erinnerung ziehen und nach und nach in die Bedeutungslosigkeit abgleiten. Man substituiert Leben mit Einrichtung.
Sessel, Sofa, Teppich, Anrichte, Kunstdruck (billiger, als er aussieht), Stehlampe, Bücherregal. Über die Hälfte der Bücher habe ich nie gelesen. Kant, Rousseau, Sophokles. Man hält sich an all dem fest, ohne es je berührt zu haben.
Das ist komisch, nicht wahr?
Die Stadt ist die Gleiche geblieben – das glaube ich zumindest. Ich laufe ziellos, ruhelos, folge ihren Venen, die sich winden, verbinden, verästeln, verlieren. Die Fremden, die mich streifen, sind das Blut dieser Stadt. Ich bin ein Fremdkörper, vielleicht, nur eine Illusion, eine Fata Morgana.
In einem Musikvideo wäre ich der graue Fleck in einer farbigen Welt. Auch das finden Sie vielleicht komisch. Oder auch theatralisch. Nun, die Wahrheit ist, dass es mich überrascht, ja, erschreckt, wenn mich auf der Straße ein Blick trifft, der signalisiert, dass ich gesehen werde. Denn ich selbst fühle mich wie ein Schatten und bin nicht sicher, ob ich stofflich bin. Wenn ich wahrgenommen werde, prallt jemand gegen das Vakuum in dem ich mich bewege. Das macht mir Angst. Es heißt, dass ich noch am Leben bin.
Vielleicht fragen Sie sich, ob ich versuche, ihre Aufmerksamkeit zu erregen, indem ich mich zu meiner Depression bekenne. Aber nein, ich versuche sie nicht „bei der Stange zu halten”. Sie müssen nicht weiterlesen. Sie würden nicht viel verpassen.
*
Ich bin seit sieben Jahren in dieser Stadt. Ich steige seit sieben Jahren in die gleichen U- und S-Bahnen, gehe auf den gleichen Bürgersteigen, passiere die gleichen Gebäude und sehe die gleichen Gesichter.
Es ist seltsam, dass die Intensität der Einsamkeit in Menschenansammlungen zuzunehmen scheint. Ich kann stundenlang die Menschen an mir vorüber hasten sehen, ohne ein Wort zu sprechen oder zu hören. Umso mehr Menschen mich umgeben, umso mehr bin ich allein.
In der Menge bin ich unsichtbar.
Ich führte ein Leben, das mir heute in der Erinnerung vertrauter ist, als die Routine der letzten sieben Jahre es jemals sein könnte, weil sie so unwirklich, weil alles so falsch ist. Es fühlt sich an, als bewege man sich als Hauptdarsteller in einem Theaterstück, dessen Ausgang man nicht kennt und erwarte das Ende der Inszenierung, ohne dass es jemals käme.
Ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen. Mein Vater ist Franzose, arbeitslos, und lebt irgendwo bei Marseille. Meine Mutter hat sich vor etwas weniger als sieben Jahren das Leben genommen.
Es gibt keinen Grund, sentimental zu werden. Man trifft Entscheidungen, weil sie getroffen werden müssen. Konsequenzen sind unvermeidlich.
Die Differenz zwischen Wissen und Empfinden ist das Entscheidende. Ich weiß, dass ich richtig handelte, als ich davon lief. Ich weiß auch, dass ich einen Menschen zurück ließ, der unsere Bindung missbrauchte, weil er allein und verzweifelt war. Ich weiß, dass dieses Verhältnis dazu bestimmt war, mich zu zerstören. Ich hasse meine Mutter nicht. Aber ich hasste mich selbst für all die richtigen Entscheidungen, die ich getroffen habe.
Anfangs führt man ein Innenleben, das einen aufzufressen droht. So viele Empfindungen und Gedanken explodieren in einem unaufhörlichen Feuerwerk. Es erstaunt mich, wie intensiv ein Mensch empfinden kann, ohne den Verstand zu verlieren. Ich sah auf mein kümmerliches Selbst mit einer kalten Faszination hinab; all meine Reaktionen, Wünsche, Gedanken verurteilte ich, als stünden sie in keiner Verbindung zu mir.
In den Filmen zeigen sie dir, wie die Menschen weinen und schreien und ihre Köpfe gegen Wände schlagen. Ich weiß nicht, ob so etwas wirklich irgendwo passiert. Ich selbst habe mit der Zeit nur noch eine Leere empfunden. Ein großer, toter Knoten sitzt in meiner Brust, in meinem Bauch, in meinem Kopf. Ich weine nicht. Ich schreie nicht. Noch nie haben mir die Hände gezittert. Ich habe immer funktioniert.
*
Was danach kam – ist nicht der Rede wert. Ich habe einige Männer gehabt und sie fort geschickt. Ich arbeitete in einem Callcenter, weil die Arbeit einfach war und man mir wenig Fragen stellte. Meine Wohnung liegt ruhig, meinen Nachbarn begegne ich selten.
Ich habe gelogen: Den sieben Jahren in dieser Stadt fehlt ein Tag, vielmehr, einige Stunden. Heute war mein letzter Arbeitstag. Es ist Freitagabend, 21.00 Uhr. Ich habe etwas mehr als eine Flasche Rotwein getrunken. Es ist die Nacht auf meinen 25. Geburtstag und in ein paar Stunden werde ich tot sein.
Es ist 22.12 Uhr. Die zweite Flasche Wein ist fast leer. Ich krame in meiner Tasche, bis ich die kleine, weiße Packung gefunden habe. Ich muss beinahe lachen. Fünfzig Tabletten, kaum einen halben Zentimeter breit. Ganz weiß und so klein.
Als ich aufstehe, um Wasser aus der Küche zu holen, wird mir schwindelig.
Im Bad sehe ich in den Spiegel und erwidere meinen glasigen Blick. Ich beobachte mich selbst dabei, wie ich dreißig Tabletten aus der Verpackung drücke.
Ich gehe ins Schlafzimmer, mein Blick fällt auf die Engelsstatue, die auf dem Fensterbrett steht. Aus einem Impuls heraus öffne ich das Fenster und werfe die Statue in die Nacht.
*
Es ist einer dieser verdammten Freitage – einer dieser Tage, an denen es schon so spät geworden ist, dass man weiß, dass einen niemand mehr anrufen wird. Einer dieser verdammten Freitage, an denen es gleichzeitig zu früh und zu spät ist. Ich laufe die Weserstraße hinunter und trete Straßenlaternen aus. Die Autos, die hier parken, wecken in mir das Bedürfnis, sie mit einem Baseballschläger zu traktieren. Ich zünde mir eine Zigarette an, während ich den Stern vom silbergrauen Mercedes-Cabrio neben mir abbreche. „Sie, junger Mann! Was machen Sie denn da?” Etwa fünfzig Meter entfernt von mir ist eine ältere Frau aufgetaucht, die ihren Dackel spazieren führt. „Ach, halt doch die Fresse, Oma!”, schreie ich und werfe den Stern nach ihr.
Als ich am Spreeufer stehe, zeigt meine Digitaluhr 21.58 Uhr an. Unter mir das leise Plätschern dieser braunen Masse, auf der anderen Straßenseite kauft eine Nutte Pommes mit Mayo im „Neptun”; ein blöde grinsender, zweidimensionaler Fischmann über ihr streckt einen Dreizack in die Höhe, dessen Beleuchtung ausgefallen ist. Autos mit getönten Scheiben gleiten vorüber. Die Straßenlaternen tauchen alles in ein gelblich-braunes Licht. Ein paar Kids mit zerpiercten Gesichtern streifen mich wie eine Handvoll Gespenster.
Ich stolpere durch die Straßen, bis ich ein Kiosk gefunden habe. Ich kaufe eine Flasche Whiskey. Ich öffne den Verschluss der Flasche und beobachte meine Hand, die eine 180 Grad Drehung beschreibt. Braune Flüssigkeit läuft in den Rinnstein.
Ich will mit jemandem sprechen. Jemanden anschreien und schütteln und so laut „Scheiße!” brüllen, dass alle ihre verdammten Fressen halten. Nicht nur die scheiß Oma, nicht nur die Mercedesfahrer, nicht nur die Zuhälter. Alle sollen ihre verdammten Fressen halten.
Ich bleibe stehen, setze die Flasche an und plötzlich fällt eine Keramikfigur direkt vor meine Füße und zersplittert. Ich springe zurück und der Flaschenhals knallt gegen meine Schneidezähne. Im Haus neben mir schlägt jemand ein Fenster zu.
Mein Puls beschleunigt sich, ich gehe hinüber und drücke meine flache Hand auf das Klingelbrett. Wer auch immer das war, wird sich wünschen, nie geboren worden zu sein.
Es knackt in der Freisprechanlage. „Wer ist da?”.
„Der, der dir gleich die Fresse poliert”, höre ich mich sagen. Zu meiner Überraschung drückt der Kerl am anderen Ende den Summer und ich renne die Treppen hinauf, nehme zwei Stufen auf einmal und kremple meine Ärmel hoch. Ich kann es kaum erwarten, Bekanntschaft mit diesem Arschloch zu machen.
Am Treppenabsatz erwartet mich ein Typ, vielleicht so um die dreißig, mit dicken, tätowierten Oberarmen. „Warst du das?”, schreie ich. „Was auch immer dein Problem ist, Kumpel, es wäre besser für dich wenn du nicht mitten in der Nacht an meiner Tür klingeln würdest. Sag Entschuldigung und hau ab.” „Ich war das”, neben uns ist eine Tür aufgegangen, in der eine zierliche Frau steht. Der Tätowierte zuckt die Achseln und verschwindet.
„War keine Absicht”, sagt sie. Aber so einfach ist das nicht. Ich bin verdammt angepisst. „War keine Absicht? War keine Absicht???”, schreie ich. Ich stürme an ihr vorbei in ihre Wohnung und schnappe mir die Vase mit Lilien, die auf dem Tisch steht. Ich reiße das Fenster auf und brülle „weißt du, was da alles passieren kann?” Noch während ich aushole, um die Vase zu werfen, sehe ich aus dem Augenwinkel, wie jemand um die Ecke biegt. Es ist zu spät. Die Vase knallt einer Nutte vor die Füße, die laut aufschreit. „Ihr verfickten Hurensöhne! Ich zeig‘ euch an!”, „Das kann passieren…” „… Emily…” „… und viel Schlimmeres!” „Ach fickt euch doch, ich hoffe ihr verreckt ihr scheiß Arschlöcher, euch werd ich’s…” „Und deshalb, Emily, wirf niemals…” „ … schon zeigen, euch werd ich…” „… eine Statue, eine Vase, einen Teller oder sonst was aus dem Fenster, verdammt noch mal…” „…fertig machen, darauf könnt ihr euch verlassen, ihr…” „… weil das scheiß gefährlich ist, hast du kapiert?”
Während die Nutte zetert und ich das Fenster schließe, steht Emily nur wie versteinert neben mir.
Ich gehe in ihre Küche und schaue in ihren Kühlschrank. Im Regal steht eine Flasche Wein. „Hey… ich… tut mir leid, aber…”, „deine Entschuldigung kannst du dir sonst wohin stecken, hörst du?” „Könnten Sie bitte meine Wohnung verlassen?”, „Nein. Du machst jetzt den Wein auf und setzt dich hin.”
*
Mein Herz rast. Dieser Typ sitzt an meinem Küchentisch und will nicht gehen. Ich kann nicht die Polizei rufen. Ich muss ihn irgendwie loswerden. Mir ist so schwindelig, ich scheine von Minute zu Minute betrunkener zu werden. 30 Tabletten schwimmen in einem Meer aus Rotwein. „Wollen Sie Geld?”, „Setz dich und mach die Flasche auf.”, „Ich habe Geld, kein Problem, ich… “, „du hältst jetzt die Fresse und trinkst den verdammten Wein mit mir, Emily.”
Ich weiß nicht, wie ich es schaffe, so ruhig zu bleiben. Draußen schreit immer noch diese Frau herum. Ich fühle mich so müde. Wir trinken Wein und schweigen. Ich trinke schnell, damit die Flasche leer wird. Die Schwere in meinem Kopf… ich fange an, doppelt zu sehen und lege den Kopf auf den Tisch. „Bitte”, flüstere ich, „bitte, geh.”
*
Emily sieht verdammt fertig aus. Irgendwie warte ich darauf, dass sie heult, aber sie heult nicht. Ich gehe aufs Klo und frage mich, warum sie nicht schon längst die Bullen gerufen hat. Ich schaue in den Spiegel und schäme mich plötzlich. Was zur Hölle mache ich hier eigentlich? Ich beschließe, mich zu entschuldigen und zu gehen.
Dann fällt mein Blick auf eine halbleere Schachtel Medikamente, die auf der Ablage liegt.
„Was ist das Emily”, ich wedle ihr mit der Packung im Gesicht herum, aber sie reagiert nicht. „Emily, verdammte scheiße, was ist das?” Emily murmelt irgendetwas, das ich nicht verstehe. Ich habe plötzlich eine scheiß Wut auf diese Frau, die ich nicht einmal kenne. „Verdammt noch mal, versuchst du dich gerade umzubringen? Hast du deshalb noch nicht die Bullen gerufen? Das kannst du voll vergessen, hörst du? So eine scheiße mache ich nicht mit! Du willst also, dass ich gehe, ja? Willst du das wirklich? Willst du an diesem scheiß Tisch verrecken?”
Gerade als ich mich voll rein steigere, klingelt es an der Tür. Ich gehe ans Fenster, um zu gucken was los ist. Draußen steht die Nutte und stemmt die Hände in die Hüften. Daneben parkt ein Polizeiauto.
Emily ist so leicht und klein, es fühlt sich an, als könnte sie mir jeden Moment aus den Händen rutschen. „Wie heißt du?”, flüstert Emily. „Gabriel, ich heiße Gabriel”, sage ich. „Dann bist du ein Todesengel.” „Heute nicht”, antworte ich. Dann öffne ich die Tür.
Letzte Einträge
Themen-Thermometer
- André-Preidel Astrid-Hoff Bernd-Mayer Blog Blogosphäre Christian-Lumma Daniel-Thiem Die-Linie-7 Die-sieben-Zwerge-von-G47 Dominik-Opalka Duisburg Flyer Franziska-Ring Hans-Joachim-Heider Info Information Jury Kellapage Kurzgeschichte Kurzgeschichten Lavendel Lyrik-Forum MP3 Nora-Lessing OpenPR PDF Philosophie-Raum Presse Promotion Prospero Remscheid Robin-Haseler Sajonara Sieben Sieben-Himmel Siebenschläfer Teddykrieger teilt-euch-mit-uns Thomas-Zelejewski Turnschuhromantik Uta-Brandschwei Verlag Wettbewerb Wordpress Zu-Risiken-und-Nebenwirkungen

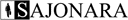
Nov 8th, 2007 at 2:34 pm
Super Plot!
Die Zusammenführung der beiden Schicksale gefällt mir.
Depression, Einsamkeit und Verzweiflung kommen unheimlich gut rüber. Auch das Ende mit dem Engel Gabriel finde ich schön.
Einzig woher der Lebensretter den Vornamen ‘Emily’ kennt, könnte besser ausgearbeitet sein (vom Klingelschild oben an der Tür?). Oder habe ich ‘was überlesen?
Nov 8th, 2007 at 6:08 pm
Gute Geschichte, passende Sprache, aber ich musste so oft nachlesen, wer jetzt was gesagt und getan hat. Wohnt die Nutte mit ihr in der Wohnung? Ist sie eine Freundin? Der Name Emily? Ist sie die zierliche Frau, die öffnet?
Nov 8th, 2007 at 6:14 pm
Es mag auch ein wenig der Formatierung geschuldet sein, die allerdings im Originaldokument der Autorin ebenfalls nicht ganz eindeutig zu entschlüsseln war. Denn eigentlich sollen die verschiedenen Abschnitte, so habe ich es abschließend verstanden, jeweils dem Antagonisten zugeordnet sein, und erst gegen Ende treffen beide aufeinander.
Nov 17th, 2007 at 5:09 pm
Die Protagonisten wechseln immer ab. im direkten Dialog ist das natürlich müßig. Zugegeben: verwirrend, wer spricht, wenn man genau liest, dürfte es aber zu verstehen sein. hauptsächlich reden Gabriel und die Frau auf der Straße durcheinander. Emily sagt genau ein Wort in diesem Absatz, und das ist ihr Name. –> “Das kann passieren…” (Gabriel), “…Emily…” (Emily), „… und viel Schlimmeres!” (Gabriel)