von Franziska Holzfurtner
Dies war der Tag, eine alte Tradition fortzuführen. Stephan war der Siebte, der dies wagen würde. Unter seinem Arm klemmte eine Mappe mit sieben Registern. Sieben Farben waren darin, für drei Mädchen und vier Jungen. Für sie alle gab es noch Hoffnung. Stephan lachte. Es war auch ein Register über ihn in der Mappe, ein Register über Stephan, über genau diesen einen Stephan und keinen anderen. Heute war Freitag, der 06.07.07, morgen würde der 07.07.07 sein, ein Samstag, der erste Tag an der Schwelle zum siebten Jahr Gymnasium, den Sommerferien. Der erste Tag im Leben von sieben Jugendlichen, die erkennen würden, was sie verloren hatten, oder was sie noch finden konnten. Wieder musste Stephan lachen. Er selbst hatte es schon gefunden. Dieser Tag war seine Bestimmung. Was danach sein würde, wusste er gar nicht, er hatte nie darüber nachgedacht. Er sperrte die Türe auf. Tagelang hatte er darüber nachgesonnen, wie er allein das tun würde: die Türe aufsperren. Der Raum war hässlich. Das war das Gute daran. Es gab Wasser, es gab Bücher, so viele, dass er sie nie gezählt hatte. Er dachte an circa 7000; die Schulbibliothek. Es gab genau sieben Sitzplätze. Er hatte noch eine große Stoppuhr dabei, die stellte er neben den Wasserspender auf den Tisch. Dann legte er die Mappe ab. Es war genau 13 Uhr 45. Die anderen müssten jetzt kommen. Und sie kamen. Zuerst erschien Francis. Stephan kannte sie schon gut, deshalb hatte er sie ausgewählt. Sie kam wegen eines angeblich überfälligen Buches. „Serva, Stephan!”, sagte sie, Humanistin. Er lächelte wieder. Er lächelte seit Tagen nur noch, er hatte sogar gelacht, als sein Vater ihm für sein Zeugnis eine geschmiert hatte. „Setz Dich!”, forderte er sie auf. „Du bist die erste, nach mir natürlich.” Francis runzelte die Stirn und pflanzte sich auf einen Sessel in der Ecke. „Die letzten werden die ersten sein!”, dachte er grinsend. Francis’ Namen hatte sieben Buchstaben, das F war der 21. Buchstabe des Alphabets von hinten. Deswegen hatte er sie als letzte ausgewählt. „Die erste für was?”, fragte sie, bohrte in der Nase und betrachtete kritisch das Ergebnis, eine kleine, grüne Kugel auf ihrem Fingernagel. Stephan verzog keine Miene. Er wusste, dass sie ihn damit provozieren wollte. „Grüß Gott, Stephan!”, wünschte Michael beim Eintreten. Er sah wie immer perfekt aus. Strahlend goldene Haare, große, dunkle Augen, aber sie waren so leer, wie zwei große, braune Murmeln. „Setz Dich!”, befahl Stephan. „Warum?”, fragte Michael und beobachtete abgestoßen Francis, die ihn ignorierte und den Popel in ein Taschentuch klebte. „Du wirst sehen!” Theresa und Natalia erschienen gleichzeitig. Natalia sah aus, als würde sie sich die Ohren zuhalten. Stumm blickte sie Stephan an. „Ich hab das Buch nicht!”, flüsterte sie. „Ich hab Geld dabei, um es zu ersetzen.” „Willkommen im Club!”, rief Theresa biestig. „Ich sag’s Dir, Du kleiner Stumpen, wenn Du hier Rache an unserer Jahrgangsstufe üben willst, dann kriegen Du und Deine Knollennase es mit mir zu tun!” – „Setzt euch einfach!”, bat Stephan freundlich. Als nächstes kam Gabriel. Ein Junge mit karrotenroten Haaren, einer abgewetzten Bundeswehrjacke und einem idealistischen Gesichtsausdruck, er setzte sich nur widerwillig. Langsam schwante es allen Anwesenden, dass Stephan irgendetwas plante. Ein Treffen oder so. „Falls Du Bibliothekare brauchst!”, sagte Francis – ein spöttischer Ausdruck in ihren trauernden Augen -, „ich bin schon für nächstes Jahr angemeldet!” Stephan schüttelte nur den Kopf. Er begann zu schwitzen. Einer fehlte noch, Ullrich nämlich. Der kam erst um 14 Uhr 15. Kaum hatte er den Raum betreten, sperrte Stephan die Türe ab. Alle starrten ihn an. Stumm. Er trat nach vorne und genoss den Augenblick. „Mein Name ist Stephan!”, stellte er sich vor. Schweigen. „Wir kennen Dich!”, kommentierte Theresa. „Ich habe euch nicht ohne Grund eingesperrt!”, sagte Stephan. Immer noch Schweigen. Hätten sich die Jugendlichen untereinander besser gekannt, hätten sie jetzt wohl miteinander gemurmelt. „Ihr seid hier, weil ihr lernen sollt!” Kunstvoll hob er seine Nase zu Himmel. Er erklärte, dass sie sieben Stunden in diesem Raum zubringen würden. Theresa sagte, sie würde bei dem ganzen Staub bestimmt allergisch werden. Alle waren schockiert, Stephan hatte damit gerechnet. Sie waren sogar zu schockiert, um ihm den Schlüssel abzunehmen. Sie starrten ihn einfach nur an, als er auf die Uhr auf dem Tisch zeigte. „Die Stoppuhr!”, sagte er. „Nach genau sieben Stunden wird jeder von euch etwas gefunden haben, was er gesucht hat, ohne vorher davon zu wissen.” Alle musterten ihn erstaunt. Einige lachten heiser. Gabriel erklärte Stephan zum Spinner.
Gabriel
Stephan drückte mit der Hand auf die Uhr. Der Zeiger begann sofort, sich zu bewegen. Natalia nahm sich wortlos ein Buch. Sie öffnete es auf der ersten Seite. Ihre Augen öffneten sich etwas weiter und sie las vor: „Du kannst die Welt nicht verändern, wenn sie es nicht will. Eher wird sie Dich zerstören!” Gabriel lachte heiser. Wieder breitete sich Schweigen aus. „Wie hast Du Dir das vorgestellt?”, fragte Theresa. „Sollen wir einfach reden?” Stephan nickte. „Hast Du nicht gehört, was Natalia da vorgelesen hat?” „Das ist Schwachsinn!”, verkündete Gabriel. „Du kannst uns nicht einfach festhalten!” Michael nickte eifrig. „Wir machen Dich locker fertig!”, verkündete der Rothaarige. Michael nickte. Ullrich seufzte. Francis lachte. „Wer? Wir?”, fragte sie. Stephan warf ihr einen dankbaren Blick zu. Er hatte das Gleiche sagen wollen. Stephan hatte gedacht, Gabriel würde am längsten dauern. Jetzt begann er schon von selbst damit. Gabriel sprang auf. „Machen wir ihn alle!”, verkündete er. Keiner bewegte sich. Stephan musterte jeden von ihnen mit einem stechenden Blick. Es passierte. Gabriel ballte ängstlich seine Fäuste. Sein Kopf lief rot an. „Wollt ihr hier denn gar nicht raus?” – „Was sollen wir denn tun?”, fragte Ullrich und betrachtete nachdenklich Natalia. „Kämpfen!”, schrie Gabriel. Er machte sich lächerlich, er machte sich so lächerlich. Stephan sah ihn überlegen an. Dann ging er zum Fenster und kippte es. Etwas Blitzendes fiel draußen herunter. Stephan drehte den Griff in aller Ruhe in die Waagrechte, während ihn alle anstarrten. Der Schlüssel lag draußen im Gebüsch. Mit einer kraftvollen Bewegung, die ihm keiner zugetraut hatte, riß er die Fensterklinke ab und ließ sie zu Boden fallen. Plötzlich war Gabriel auf Stephan zugesprungen und würgte ihn gegen die Wand. Immer fester schlossen sich die Hände mit den teilweise schwarz lackierten Fingernägeln. Francis sah nicht mal richtig hin. „Du erwürgst unseren Ersatzschlüssel!”, sagte sie trocken. Plötzlich waren Michael und Theresa aufgesprungen und zerrten den um sich schlagenden Gabriel von Stephan fort. Der griff sich lächelnd an den Hals. Er blickte zur Uhr. Keine 10 Minuten und der erste war handgreiflich geworden. Er spielte keineswegs ungefährlich. Michael und Theresa hielten Gabriel, beide vollkommen ruhig. Dieser schüttelte seinen punkigen, schlampigen Haarschnitt in karottenrot. „Ihr müsst mir helfen!”, schrie er. Stephan trat so weit vor Gabriel, dass er ihn genau sehen musste, aber nicht erwischen konnte. „Hör mir zu!”, befahl er. Michael und Theresa sahen sich gegenseitig an. Sie wussten, dass sie hier nie herauskämen, wenn sie Stephan mit dem Wissen um den Ersatzschlüssel an Gabriel auslieferten. Gabriel fragte nicht lang, ob das Volk von ihm vertreten werden wollte, er vertrat es einfach, mit Fäusten. „Ich will, dass Du Dir genau vorstellst, was ich Dir jetzt sage.” Gabriel fletschte die Zähne. Natalia zuckte hinter ihrem Buch zusammen. Francis lächelte abweisend. Ullrich holte ein Blatt aus seiner Tasche und strich alles, was er bis jetzt geschrieben hatte. Stephan blieb ruhig. Bereits jetzt wurde er auf eine Probe gestellt. „Stell Dir vor, es hätte Dich nie gegeben”, sagte er beschwörerisch. „Stell Dir vor, diese Welt wäre ohne Dich, stell es Dir vor.” Gabriel sah ihn geschwächt an. „Ich kann mir meine Welt nicht ohne mich vorstellen”, flüsterte er. „Ganz recht”, sagte Stephan. „Denn es ist Deine Welt, die Du siehst. Aber nun stell Dir vor, wie viele Köpfe es auf der Welt gibt. Genau so viele Geister gibt es auf der Welt, Gabriel. Jeder Geist ist anders. Manche sind recht ähnlich, manche sind unter Deinem Niveau. Aber jeder ist anders. Du willst für diese Geister reden Gabriel. Das ist edel. Aber entscheide Dich: Redest Du für die Geister, oder für Dich?” „Für alle”, zischte Gabriel „Das gleiche gilt für alle. Nur so kann es Gerechtigkeit geben.” Michael und Theresa hielten ihn. „Ist es gerecht, zu glauben, dass alle das gleiche wollen?”, fragte Stephan. „Nicht alle wissen, was gut für sie ist!”, sagte Gabriel, wie unter Schmerzen. Er hing in Michaels und Theresas Armen. „Weißt Du, was gut für Dich ist?”, fragte Stephan. „Freiheit!”, rief Gabriel aus. „Weißt Du, was absolute Freiheit ist?” – „Ja!” – „Beschreib es mir!” Er schwieg. Der selbsternannte Held schwieg. Francis trockenes Lachen raschelte durch den Raum. „Als Schülersprecher wirst Du nicht unbedingt freier!”, kommentierte sie. Gabriel krümmte sich. Er hing mit verwundbarem Bauch an die Wand gekettet und diejenige, die er noch nie vertreten hatte, die das gar nicht wollte, hatte ihm gerne in die Magengrube getreten. Er wollte Schülersprecher werden, nächstes Jahr, in der 7. Gymnasium, der 11. insgesamt. Stephan griff nicht ein. „Ich bin die Stimme… der Stimmlosen”, sagte er eigensinnig. Dabei sah er Natalia an. Sie blickte in ihr Buch. „Du sprichst nicht ihre Sprache, wie willst Du ihre Stimme sein?”, las sie vor. „Denk nach!”, drang Stephan auf Gabriel ein. Michael und Theresa ließen ihn los, dass er zusammensackte. Auf die Knie. Der Held, zu Füßen des Volkes. Er sah auf, zu allen. Plötzlich weiteten sich seine Augen. „Einer, der für das Volk spricht, ist nicht sein Regent, sondern sein Diener!”, sagte er mit heiserer Stimme. Er hatte alles gesagt. Wortlos riss Stephan die Akte aus dem Ordner, auf der „Gabriel” stand. „Gabriel beginnt mit dem 7. Buchstaben des Alphabets und hat selbst sieben Buchstaben. Weltliche Vollkommenheit ist die 4, göttliche die 3.” Gabriel sah ihn an. „Wir sind sieben!”, sagte er. „Drei besuchen den Religionsunterricht, vier nicht.” „Wir sind drei Mädchen und vier Jungen. Zwei Vollkommenheiten bilden die absolute Vollkommenheit!”, ergänzte Stephan und seine Augen funkelten. „Gabriel ist der Erzengel der Verkündigung. Er ist der Diener des höchsten Dieners, er ist sein Mund.”
Theresa
„Wie jetzt? Die soll vollkommen sein?”, fragte Theresa mit einem Blick auf Francis, die gerade ohne sich die Hand vorzuhalten gähnte. „Mit Dir zusammen”, sagte Stephan. „Dieses Mädchen ist ekelhaft und ungehobelt. Warum kannst Du Dich nicht benehmen, Francis, warum nicht?” Francis blickte sie gelangweilt an. „Soll ich mich etwa für Dich gut benehmen?” Die Frage war rhetorisch gemeint. „Nein”, sagte Theresa. „Für alle! Damit Du Dich selbst besser fühlst!” Francis lachte. Stephan bedeutete ihr, zu schweigen. Francis wäre für sein Amt selbst gut geeignet gewesen, nur war sie zu radikal. „Was würden dann die anderen mögen? Dein Benehmen, oder Dich selbst?”, fragte Stephan. „Keiner mag so eine fette Kuh, wie mich!”, rutschte es Theresa heraus. Das machte die Sieben, dass plötzlich alle sagten, was sie meinten, dachte Stephan zufrieden. „Du bist nicht fett”, sagte Michael korrekt. „Ach ja?”, fragte Theresa. „Ich kann selbst nicht die Dinge tun, die ich liebe, nur weil es besonders viel von mir gibt. Ich hasse jeden Teil von mir”, flüsterte sie. „Und ich habe außergewöhnlich viele Teile, die ich hassen kann!” „Du scheinst mehr die anderen zu hassen, als Dich selbst”, bemerkte Stephan. „Oder ist das Neid?” – Theresa prallte keuchend zurück. Sie stolperte über Gabriel, der am Boden saß und in Gedanken war. Ihre Augen verengten sich. „Ihr seid so schön und verschwendet es. Und ich bin hässlich und muss euch dabei zusehen”, sagte sie. Sie spuckte auf den Boden. „So viel sinnlose Schönheit!”, sagte sie mit schriller Stimme. „Wer sagt schon, was schön ist?”, fragte Stephan. „Schönheit ist nur ein Blick in einen Spiegel am Mittag. Keiner ahnt, was des Nachts für ein Gespenst an ihm vorüberzieht, ist es doch derselbe Mensch”, las Natalia. „Wer sagt das schon? Keiner sagt, was schön ist, alle sagen nur, was hässlich ist!” – „Was nicht hässlich ist, muss noch lange nicht schön sein.” – „Aber ich bin es, ich bin hässlich! Die Welt ist sich ihrer Schönheit nicht bewusst!” Plötzlich hatte sie eine Schere in der Hand. Die aufgeklappten Schneiden zeigten auf ihren Magen. „Sie ist schön und weiß es nicht”, flüsterte sie. „Gehörst Du etwa nicht zu Deiner eigenen Welt, die Du hässlich redest?”, fragte Stephan – leichte Verzweiflung schwang in seiner Stimme. „Du und Deine Welt, ihr seid eins!”, redete er los. „Bedenke, aus wie vielen einzelnen, unendlich schönen und wundersamen Teilen Du bestehst! Dein Leben ist schön, Du bist so schön, wie Du die Welt um Dich herum machst!” – „Wenn ich nicht existiere, muss diese Welt auch nicht mehr existieren!” – „Vielleicht will sie aber existieren?!”, versuchte es plötzlich Gabriel. Stephan zischte sie alle ruhig. Theresa betrachtete zitternd und weinend die Schere, die sie sich mittlerweile selbst an den Hals hielt. „Wenn Du jetzt gehst…”, flüsterte Stephan in einer letzten Anstrengung. „Wenn Du jetzt gehst, dann wirst Du für immer dieses Mädchen bleiben, das Du jetzt bist. Weinend, in Deiner eigenen, hässlichen Welt.” Metallisch klappernd fiel die Schere zu Boden. „Man ist so schön, wie man die Welt um sich herum macht!”, wisperte Theresa, ihren eigenen Bauch umarmend. Dann blickte sie in die Runde, betrachtete all die menschlichen Gesichter und lächelte. Sie lächelte so echt, wie schon seit Jahren nicht mehr, es sah aus wie das erste Lächeln eines Kindes, aber es war das erste Lächeln eines Erwachsenen. Wortlos nahm Stephan ihre Akte und gab sie ihr. „Theresa”, sagte er. „Mutter Theresa ist keine äußerlich schöne Frau, aber sie machte diese Welt schöner. Auch sie hätte sich beklagen können. Theresa trägt sieben Buchstaben. Der Name beginnt mit T, es ist der einundzwanzigste Buchstabe des Alphabets, das ist dreimal sieben, Theresa.”
Michael
Alle applaudierten stumm, Stephan setzte ein zufriedenes Grinsen auf. Sie begannen, sich in sein Spiel einzufügen, sie nahmen es an. „Sieben Stunden sind eine verdammt lange Zeit”, sagte Michael. Jetzt sind gerade mal zwei Stunden um. „Zwei Stunden schon?”, fragte Gabriel überrascht. „Wir haben hier doch nur geredet.” Francis rechnete kurz nach. „Wir müssen hier bis 21 Uhr bleiben!”, sagte sie, leicht empört. „Stephan, wie sollen wir das unseren Eltern erklären?”, fragte Michael. „Ich habe euren Eltern Briefe zugesendet, ihr müsstet hier ab vierzehn Uhr Strafdienst schieben. Sie sollten euch nicht drängen, hinzugehen, auch nicht sagen, dass sie davon wissen, damit ihr euch selbstständig aufmacht.” – „Aber bis 21 Uhr?”, fragte Michael ungläubig. Da wird meine Mutter doch denken, ich hätte sonstwas angestellt!” – „Um 21 Uhr verlässt der Direktor sein Schulgebäude. Ich habe ihnen geschrieben, ihr würdet ihm helfen.” Michael schnappte nach Luft. Er hatte sich nie etwas zu schulden kommen lassen und nun glaubte seine Mutter, er müsse nachsitzen, am letzten Tag vor den Sommerferien, von 14 bis 21 Uhr. „Deswegen wollte meine Mutter mich abholen!”, rief Theresa aus. Michael katapultierte sich selbst an den Rand der Verzweiflung. Natalia saß aufrecht auf dem Sofa, neben Ullrich, der auf seinen Knien schrieb. Ihr Blick war aufgeschreckt. Sie wollte etwas sagen, aber sie biss sich auf die Lippe und vertiefte sich wieder in ihr Buch. „Was soll ich nur tun, was soll ich nur tun?!”, fragte der ehemals perfekte Michael. „Erhäng Dich doch!”, riet Francis. Dieser Lackaffe ging ihr gehörig auf den Keks. Stephan ließ sich als dritter auf das Sofa fallen. Er konnte nicht mehr. Vorerst nicht. Michael starrte das Mädchen seltsam an. „Wie meinst Du das?” – „Nicht ernst.”, sagte Francis, plötzlich erschrocken, er könne sich wirklich aufhängen. „Nein, Du bist genial!”, sagte Michael. Francis sah alarmiert drein. Was war heute nur für ein verrückter Tag, dachte sie, dass alle ihrem oder anderen Leben ein Ende setzen wollten. Alle starrten Michael an. „Leute, ihr müsst mir dabei helfen! Ich nehme die Schere und schneide mir damit die Pulsadern auf. Ihr setzt mir dann gleich einen Druckverband an, mir passiert nichts, meine Eltern sind mir nicht böse, sondern froh, dass ich lebe!” Francis Augen wurden kugelrund. „Sag mal… schämst Du Dich denn gar nicht?”, fragte sie entsetzt. Michael blickte sie verwundert an, von seinem Unterarm aufschauend. „Scham bedeutet, ein zunächst höheres Ziel hinterher als ein niedrigeres zu erkennen!”, las Natalia. „Was?”, fragte Francis. Stephan antwortete an ihrer statt. „Du schämst Dich immer dann, wenn Du hinterher bemerkst, aus welch niedrigen Beweggründen Du gehandelt hast und was Du damit angerichtet hast.” Michael sah sie immer noch alle verwundert an. „Du möchtest Deinen eigenen Körper beschädigen, Deine Eltern anlügen und uns dazu zwingen, Dir zu helfen, alles nur, damit Du nicht als fehlerhaft erscheinst?”, fragte Francis, mit ungläubigem Blick. „Ich dachte immer, Du schwebst in höheren Sphären, dabei bist Du nichts anderes als ein erbärmlicher, kleiner Käfer, der vom Hautfett in den Badewannen anderer Leute lebt.” Allen klappte der Unterkiefer hinunter, besonders Michael. „Du durchschaust die Menschen, als wären sie aus Glas”, flüsterte Stephan. „Er ist nur Blendwerk”, sagte Francis, mehr zu sich selbst, als zu jemand anderem. „Ein schillernder kleiner Käfer.” Michael weinte, ja, er weinte plötzlich. Tränen liefen seine Wangen hinab, kleine, silberne Tränen, genau wie eben diese Käfer, die Francis gemeint hatte. Und keiner würde es hinterher glauben, hätte er es nicht selbst gesehen, aber Francis verließ ihren Sessel und kniete sich neben Michael auf dem Boden, der da saß, die Beine angewinkelt, die Tränen liefen ihm die Wangen hinunter.
Francis
Francis durchschaute nicht nur die anderen, sie durchschaute sich selbst und sie sah, dass auch sie nur Blendwerk war. Sie war nichts, als ein ekelhaftes Waldtier, das Urlauber mit seinem Gift vertrieb und von ihren zurückgelassenen Lebensmitteln lebte. Aber sie ließ sich nicht so leicht zerquetschen wie Michael. Sie nahm sein Gesicht zwischen ihre Hände. Sie waren rauh und ein wenig staubig. Michael blickte sie an. „Wenn ich nur Blendwerk bin, was bist Du?” – „Ich bin ein Igel mit Glasstacheln”, flüsterte sie. „Aber jeden Tag wachsen die Stacheln und der Igel wird kleiner. Der Igel liegt in seinem kristallenen Schloss und betrachtet die anderen. Er ist froh, dass er leben darf, aber heute hat er jemanden berührt. Er weiß nicht mehr, ob das gut, oder schlecht war, früher; aber heute, heute ist es gut. Die Glasstacheln um ihn herum sind das, was die anderen sehen. Eine Extremform seiner selbst.” Alle betrachteten sie mit offenen Augen. Natalia setzte an, vorzulesen, aber Ullrich hielt ihr den Mund zu. „Was ist Gott?”, fragte Stephan. Francis stand auf und half Michael auf die Beine. „Gott ist das, was wir mit unserem Blendwerk schützen wollen und das, was das Blendwerk am Ende zerschlägt.” – „Ist Gott die Liebe?” – „Gott ist das Leben”, las Natalia vor. „Gott ist alles, was da ist.” Francis umarmte Michael, der sein Gesicht in ihre Haare drückte. Wie eine Statue standen sie im Zimmer. Stumm riss Stephan zwei weitere Register aus der Verankerung. Er wollte sie den beiden geben, legte sie aber nur auf den Schreibtisch. „Der vierzehnte Buchstabe des Alphabetes von unten ist ‚M’. M wie Michael. Michael trägt sieben Buchstaben. Michael, so heißt der Erzengel, der die himmlischen Heerscharen anführt. Er setzt seine Fähigkeiten für den höchsten Herrn, den er kennt, ein. Warum solltest Du das anders sehen?” Gabriels Stimme war nur ein leiser Hauch, als er sagte: „Jeder Erzengel hat sieben Buchstaben”, flüsterte er. „Raphael, Michael, Gabriel… und auch Luzifer.” Dann wandte sich Stephan Francis zu. „Der 21. Buchstabe des Alphabetes von unten ist das ‚F’ und auch Dein Name, Francis, hat 7 Buchstaben, wenn es auch nur eine Abkürzung ist.” Alle warteten nun auf einen Namensvetter, aber es kam keiner. „Francis ist einfach Francis”, erklärte Stephan nach einer Weile und winkte ab. „Die kann man mit nichts vergleichen.” Alle, bis auf Natalia und Ullrich lachten. Die beiden blickten einander an, Ullrich las in Natalias Buch, Natalia las das, was Ullrich schrieb und beide schienen in Rätseln.
Stephan
Die Stoppuhr tickte leise. Mit Stephan blickten gleich alle zu ihr hin. Genau 4 Stunden waren nun vergangen, es war 18 Uhr 15. Das Kellerfenster bekam kein Licht mehr. Ullrich hätte bestimmt im ungesunden Halblicht weitergeschrieben, Natalia stand auf und ließ den Lichtschalter umschnappen. Sofort blinkten die Neonröhren. Natalia setzte sich und nahm das Buch zur Hand. Vier Stühle im Raum waren frei, ihre ehemaligen Beleger saßen alle auf dem Boden mit den Rücken zu Wänden oder zu Bücherregalen. Michael und Francis saßen direkt nebeneinander. Ihre Köpfe lehnten aneinander und seine blonden Haare vermischten sich mit ihrem festen, dunklen Haar. Er hielt ihre Hand, als wolle er den Igel zwingen, länger dazubleiben. „Gott…”, las die Griechin Natalia in die Stille hinein. „Gott weiß, dass sich die Menschen identifizieren, mit sich selbst. Gott weiß, dass sie sich ihrer selbst bewusst sind. Aber ist sich Gott seiner selbst bewusst?” „Was ist das für ein Spiel?”, fragte Francis leise. „Stephan? Wir haben sieben Stunden Zeit, jeder von uns muss etwas Neues erkennen in seinem Leben. Aber wir sind nur sechs, Stephan.” Jeder wusste im Raum, was sie damit hatte sagen wollen. „Stephan!”, sagte Gabriel und stand auf. Alle nickten ihm zu. „Stephan, wir wollen die Akte über Dich sehen.” Keiner von ihnen hatte es gewagt, in die eigene Akte zu blicken, die er erhalten hatte, hinterher. Aber sie ahnten, dass es über jeden von ihnen so eine Akte gab. Die Augen des Jungen weiteten sich, seine Hände zitterten. „Du kannst nicht unseren Therapeuten spielen, wenn Du selbst nicht therapiert bist!”, sagte Gabriel. Allgemeines Nicken. Stephan blickte sich um. Wäre ihm in diesem Moment etwas durch den Kopf gegangen, hätte er etwas sagen können, aber er war leer. Er hatte ein ganzes halbes Jahr nur mit der Planung verbracht, jetzt war nichts übrig von ihm. Jeden Moment hatte er durchdacht, nur nicht den, in dem er selbst erkennen musste. Auch er hatte nicht in seine Akte gesehen. Nur in die der anderen. Stumm nahm er den Ordner auf und gab ihn hinüber, zu Francis hin, die die Hand fordernd ausstreckte. Sie klappte sie auf und alle versammelten sich hinter oder neben ihr, um den Inhalt zu betrachten. Sie blätterte an den Registern „Ullrich” und „Natalia” vorbei, um auf „Stephan” zu stoßen. Mit fliegenden Fingern nahm sie das Deckblatt beiseite. Das Blatt war leer. Die Seite war mit nichts beschriftet, nur oben stand Stephans voller Name und links klebte ein Photo von ihm. Er als Kleinkind. Francis schnaubte überrascht. Sie nahm ihre Akte vom Tisch und öffnete sie. Hier war ein recht aktuelles Photo von ihr, aber sie konnte sich gar nicht daran erinnern, wann es gemacht worden war. Dann stand da ihr Name, darunter aufgereiht jede Menge Aussagen, die sie gemacht hatte, zum Teil geistreiche, zum Teil weniger geistreiche. Schließlich noch eine kurze Beschreibung von ihrer Persönlichkeit. Sie schüttelte den Kopf. „Stephan, Du bist einfach leer”, stellte sie fest. Stephans Gesichtszüge entgleisten. „Leer?”, fragte er. „Ein unbeschriebenes Blatt Papier”, ergänzte Michael. „Wie lange planst Du diese Aktion eigentlich schon?”, fragte Gabriel und runzelte die Stirn. „Seit zwei, drei Jahren”, antwortete Stephan leise. „Du bist in drei Jahren Vorbereitung kein einziges Mal auf die Idee gekommen, Dich selbst zu beschriften?!”, keuchte Francis. Der Junge zuckte die Schultern. „Ich? Ich… ich, ich bin… ich hatte… i-ich weiß”, stammelte er vor sich hin. Theresa schüttelte nur stumm den Kopf. Natalia flüsterte Ullrich etwas zu, beide senkten wieder ihre Köpfe über ihre Papiere. Stephans Unterlippe zitterte, als er sagte: „Nichts.” Er presste seine beiden Fäuste gegen die Stirn. „Nichts”, flüsterte er ein weiteres Mal. „Das stimmt gar nicht!”, sagte Michael und stand neben Francis auf, die beinahe umgekippt wäre. „Niemand kann ‚nichts’ sein!” Hilfesuchend blickte er sich um. „Sieh uns an!”, sagte Francis und hob die Arme. „Dank Dir haben wir angefangen, nachzudenken. Über unsere Arroganz, unsere Mauern, unsere… Scheinexistenz.” Das letzte Wort war ihr leise über die Lippen gekrochen. Stephan winkte ab. „Nein, weißt Du, ich finde, das kannst Du richtig gut”, ergänzte Gabriel. „Du solltest das nicht nur bei uns sieben tun, Du solltest das bei der ganzen Welt tun.” – „Nein, es geht nur bei uns 7 und nur am heutigen Tage”, erwiderte Stephan. „Das ist die Magie der sieben…” „Quatsch!”, lachte Gabriel. „Das bist doch Du!” – Stephans Achseln zuckten mehrmals auf und ab. „Du bist doch jemand!”, sagte Michael und knuffte ihn kameradschaftlich in den Arm. Stephan lächelte müde. Er nahm seine Akte, seine leere Akte und zerfetzte sie. Wie großer, zusammengeklebter Schnee fielen die Schnipsel zu Boden. Natalia sah den Fetzen nach, die direkt vor ihre Füße fielen. Stumm ließ sie das 5. Buch neben sich zu Boden gleiten als plötzlich die Uhr lauter tickte, als sonst: 20 Uhr. Die Zeit schien schneller zu vergehen als sie es außerhalb dieses Raumes tat.
Ullrich und Natalia
Stephan verbarg sein Gesicht in seinen Händen und ließ sich auf den kaputten Sessel fallen, einen leisen Seufzer ausstoßend. Dann war es still. Ullrich summte leise vor sich hin. Kritzelte auf seinem Blatt, summte die gleiche Melodie mit ein paar veränderten Tönen, kritzelte weiter, summte, kritzelte. „Was machst Du da?”, fragte Francis und beugte sich über das Blatt. „Komponierst Du?” „Das geht Dich nichts an!”, knurrte Ullrich. Das hätte er besser nicht getan. „Lass mal sehen!”, rief Francis aus, schnappte ihm das Blatt weg und betrachtete es mit gerunzelter Stirn. „Sind das Gitarrenakkorde?” „Nein, das ist ein spezieller Code”, sagte Ullrich, stand auf und wischte sich die Hände an der Hose ab. „Damit es nicht jeder Idiot lesen kann.” „Kann es denn überhaupt jemand lesen?”, fragte Francis provozierend. Wortlos riss Ullrich ihr das Blatt aus der Hand. „Nein, man kann es, kann es nicht lesen, wenn ich es nicht will.” „Was ist, wenn Du morgen stirbst?”, fragte ganz plötzlich Natalia. Gekrümmt saß sie über ihrem 6. Buch. „Dann wird das nie jemand verstehen”, antwortete sie selbst. Ullrich runzelte die Stirn. Er fühlte sich gestört, in seinen Kreisen. Mit einer krampfartigen Bewegung knüllte er das Blatt Papier zusammen. „Wenn ich etwas geheimhalte, dann müsst ihr mir das auch zugestehen. Dadurch, dass ihr mir hier auf die Pelle rückt, werde ich es euch bestimmt nicht verraten.” „Was soll denn der Scheiß?”, fragte Francis. Ganz plötzlich war sie richtig wütend geworden. „Einer nach dem anderen von uns startet hier seinen Seelenstriptease und Du bist zu verklemmt, um uns die paar Noten zu verraten.” „Halt den Mund!”, fuhr Michael sie plötzlich an. Das Mädchen zuckte zusammen, als hätte sie einen Schlag in ihr Gesicht bekommen. Sie muffelte noch ein paar Worte hinterher, die keiner verstand, dann ließ sie sich zurück auf den Boden gleiten. Ullrich entknitterte das Papier in seinen Händen und versuchte es, zitternd, glattzustreichen. Dann ließ er es langsam in Natalias Schoß fallen. Das Mädchen ergriff es. Lockige, dunkle Haare fielen in ihr Gesicht, während sie konzentriert die Buchstaben darauf las. „Man muss jeden siebten lesen”, sagte sie. „Wenn man unten angekommen ist, dann muss man oben mit zählen weitermachen.” Überrascht blickte sie zu Ullrich auf, der die Fäuste in die Hosentaschen gerammt hatte. „Du machst Dir eine Menge Arbeit.” Ullrich nickte nur. „Für Dich”, sagte er, stimmlos. Nur Natalia sah es. „Das… das ist schön”, stotterte sie. „Aber nur ein Text, Du singst es doch, oder?” „Und, was sagst Du?”, fragte Ullrich. „Was soll ich denn sagen?”, fragte sie, einen hilflosen Ausdruck im Gesicht. „Ich kann Dir nicht sagen, was Du sagen sollst, Du musst es selbst tun.” „Ach, es ist Dir doch sowieso egal”, sagte sie plötzlich und verschränkte die Arme vor der Brust. „Egal?”, fragte Ullrich und taumelte zurück. „Egal?”, seine Stimme wurde so leise, dass es wie ein Schrei war. „Es ist mir nicht… gleich. Was Du denkst möchte ich hören.” Verschränkte Arme. Auf beiden Seiten. Michael wollte irgendetwas sagen, aber Francis legte den Finger auf die Lippen. „Ich bin einsam”, sagte Ullrich. Sie alle waren einsam. Alle sieben. Ullrich und Natalia schwiegen. „Sag etwas”, flüsterte Ullrich. Seine Knie gaben nach. „Sag etwas.” Keiner wusste, was auf dem Zettel gestanden hatte, aber es schien für beide wichtig zu sein. Natalia blickte den Jungen hart an. „Ich… ich kann nicht sprechen”, flüsterte er. Natalia schüttelte den Kopf. „Außerdem hört mir keiner zu. Wie solltest Du mir zuhören.” Er drehte sich zu Stephan um. „Gib mir den Schlüssel. Ich will gehen”, sagte er. Stephan blickte ihn aus verheulten Augen an. „Im Leben nicht.” Ullrich drehte sich im Kreis. Plötzlich schrie eine fast unbekannte Mädchenstimme: „Wer nie spricht wird nie verstanden. WER NIE SPRICHT WIRD NIE VERSTANDEN!” Mit einem lauten Knall fiel Natalias siebentes Buch von ihrem Schoß. Sie schloß den Kiefer und öffnete ihn wieder. „Das steht nicht in Deinem Buch, oder?”, fragte Ullrich. „Es steht bestimmt in irgendeinem”, antwortete sie und blickte zur Seite. „Du bist brillant”, sagte er und seine Augen glitzerten. „Keiner Deiner Sprüche steht in Deinen Büchern.” Natalia lachte. „Ich liebe Dich so geheim, dass jeder Tag eine kleine Feier wird, an dem ich Dich einmal ansehen darf und Du rätselst mich so tief, dass ich jede Stunde feiern muss.” Schweigen. „Das hast Du geschrieben.” „Ich weiß”, sagte Stephan mit trockener Kehle. „Du bist brillant”, sagte sie. Plötzlich gab es einen Klingelton. Die Zeiger der Uhr standen auf 7 Stunden, es war 21 Uhr 15. „Zwei Stunden?”, fragte Theresa. „Wir haben zwei Stunden nur geschwiegen?” „Aber wir haben doch gesprochen!”, sagte Natalia. Ullrich lächelte, er half ihr vom Sofa auf. „Es ist Zeit”, sagte Stephan. Aber er rührte sich nicht. „Los, sperr schon auf!”, sagte Francis. „Ich brauche jetzt langsam meine Freiheit. Außerdem habe ich Hunger!” „Ich kann nicht”, sagte Stephan. „Ullrich und Natalia haben den Schlüssel.” Natalia sah Ullrich an. „Hiiiiiiilfeeeeeeeeeee!”, schrieen sie plötzlich im Chor. „Hiiilfe?! Ist da jemand? Im Keller! Wir sind im Keller!” Tatsächlich. Kaum etwas später wurde die Türe geöffnet. Im Rahmen stand ein ziemlich verdutzter Hausmeister. „Tut mir Leid, wir hatten was vergessen”, sagte Francis, als sie an ihm vorbeimarschierten. Michael legte ihr den Arm um die Hüften und zog sie im Gehen seitlich an sich. Sie wehrte sich nicht. Natalia plapperte fröhlich auf Theresa ein. Gabriel schwieg. Es war der 7.7., 21 Uhr 22. die Quersumme der Uhrzeit ergibt 7. Die Quersumme von Datum und Uhrzeit ergibt Drei mal sieben. Einundzwanzig. Die Quersumme ist 3, die göttliche Vollkommenheit. Niemand der 7 konnte sich diese Ereignisse wirklich erklären, aber das muss man gar nicht auf Seite Sieben.
Letzte Einträge
Themen-Thermometer
- André-Preidel Astrid-Hoff Bernd-Mayer Blog Blogosphäre Christian-Lumma Daniel-Thiem Die-Linie-7 Die-sieben-Zwerge-von-G47 Dominik-Opalka Duisburg Flyer Franziska-Ring Hans-Joachim-Heider Info Information Jury Kellapage Kurzgeschichte Kurzgeschichten Lavendel Lyrik-Forum MP3 Nora-Lessing OpenPR PDF Philosophie-Raum Presse Promotion Prospero Remscheid Robin-Haseler Sajonara Sieben Sieben-Himmel Siebenschläfer Teddykrieger teilt-euch-mit-uns Thomas-Zelejewski Turnschuhromantik Uta-Brandschwei Verlag Wettbewerb Wordpress Zu-Risiken-und-Nebenwirkungen

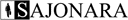
No Comments
Leave a Comment
trackback address
You must log in to post a comment.