von Manuel Hoffmann
01.07.1985, 13.00 Uhr, mittags. Eine Straße in einer Stadt. Ein zitriger Greiser läuft auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Seinen Körper stützt er mit der Rechten auf seine vergilbte Krücke. Ein brauner Hut, als Sonnenschutz und eine schwarz begläserte Brille lassen den Tattergreis wie einen Rockopi erscheinen. Auch seine ganze Gangart lässt keinen anderen Gedanken zu. Ein Schritt, die Stütze, ein weiterer Gehversuch, fast ohne Krücke drei Schritte, und dann, der Fall. Nein, er hat sich noch auf die Krücke gerettet. Wieder folgt ein Schritt. Wie ein Baby, das das Laufen erst noch lernen muss – verkehrte Welt. Wind, starker Wind zieht auf. Sein Karohemd fängt an zu flattern. Mit der Linken hält er mit aller Kraft seinen Hut fest. Ein Lastwagen fährt an dem Mann vorbei, zwingt ihn fast in die Knie. Er stützt sich ganz auf seinen Stock. Und da passiert es. Sein Hut fliegt weg. Aufgewirbelt verlässt er langsam seinen Besitzer, vorbei am nächsten Kiosk, fliegt er hoch über Sträucher, fast auf die Straße und wieder zurück auf den Bürgersteig. Knapp neben einer Parkbank landet der braune fetzen Stoff, ganz sacht. Man möchte meinen, dass es ein Leichtes wäre, das braune Etwas aufzuheben und kurz dem Alten zu überreichen. Doch kein Mensch ist weit und breit in Sicht, in einer 5-Millionen-Stadt. Wie ausgestorben ist die Gegend. Und der Alte will doch nur seinen Hut. Er fängt an, sich zu seinem Hut vorzukämpfen. Die Dunkelheit bricht ein und der Greis ist fast schon am Kiosk vorbei. Eine Laterne leuchtet, als wäre sie nur auf ihn gerichtet, denn keiner ist da. Noch ein paar Schritte und dann hat er es endlich geschafft. Der verlorene Hut ist in seinen Händen, man sieht es förmlich. Tak, und wieder bewegt er sich drei Schritte. Hinter der Laterne angelangt, da liegt der Hut, verschollen, einsam, Stunden ohne Besitzer. Er greift den Hut, doch genau in diesem Moment jaulen die Sirenen, Lautsprecher gehen an und eine Stimme ruft: «Sturmalarm Stufe 15, bitte suchen sie schnellstmöglich ihre Häuser auf! Sturmalarm! Sturmalarm! Suchen sie schnellstmöglich ihre Häuser auf!» Die Stimme wiederholt sich fortwährend und die Masse bricht in Panik aus. Sie rennen alle in die Häuser, kreuz und quer, nur ganz schnell weg. Die Sonne scheint und ein Mann greift den Alten am Arm. Dann packt ihn noch jemand, diesmal eine Frau. Sein Hut fliegt weg, an einem dutzend Menschen vorbei, die alle kreischen und zu fliehen versuchen. Er wird geschleppt, auf den Schultern der Frau und des Mannes ohne Namen. Doch sein Hut ist in der Menge untergegangen. Sie können ihm kaum helfen, doch zu zweit tragen sie ihn hinein ins Sichere, Warme. Wir haben den 01.07.1985. Es ist 13.15 Uhr.
Fast tot und doch wieder am Leben. An einem anderen Ort, 13.15 Uhr. Dort wo der Mensch noch nicht vergessen ist. Es ist nur eine kleine Hütte, eher eine hölzerne Bruchbude als ein Haus. Und doch ist er stolz darauf. Der Kleine, 8 Jahre alt, hat es ganz allein mit seiner Familie gebaut. Das 30 m² Schloss, er nennt es liebevoll «Unser Reich», ist Wohnraum für sechs Personen, seinem Vater, der Mutter und den drei Geschwistern des Kleinen. Neuerdings sind es nur noch fünf, da der Jüngste beim Spielen in eine tückische Falle geraten ist. Nur Sand und Steine weit und breit. Er konnte, wie der Rest der Familie, nicht lesen und ist, trotz mehrmaliger und eindringlicher Hinweise und Verbote der Eltern ins anliegend umzäunte, dennoch schlecht gesicherte, Minenfeld gerannt. Sein Grab ist die Wüste, da keiner die Fetzen des kleinen Jungen mehr finden konnte. Man selbst konnte auch nicht in die Verbotene Zone. Man sieht was passiert. Kurze Trauer und weiter geht das Leben. Es wird gekocht, ein Rind aus der Nachbarschaft. In einem großen Topf gebettet auf Feuerholz, brodelt das Hinterbein des Tieres. Es könnte auch der Jüngste sein, wäre er nicht schon tot. Ein Pickup wirbelt Sand auf, hält direkt vor der Familie. Zwei Männer steigen aus: «Im Namen der Revolution, für eine bessere Welt. Ihr Sohn wird für den Kampf benötigt! Es ist ein Befehl des Revolutionsführers.» Krieg spielen, der Junge ist begeistert. Heroisch meldet er seiner Familie: «Ich gehe, im Namen der Freiheit, für uns!» Seine Familie kann ihn nicht überzeugen. Die Mutter versucht ihre schützende Hand über den Kleinen zu werfen, da wird er schon von den Uniformierten weggezogen: «Ihr habt ihn gehört. Ein tapferer Krieger, aus einem starken Land!» Sie fahren davon. Der Pickup reist durchs Gebirge, zur Front. Doch wo ist die Front? Schüsse fallen aus dem Hinterhalt. Der Fahrer wird am Hals getroffen. Er versucht zu schreien, Blut fließt aus der Wunde, es strömt wie ein Wasserfall. Sekunden später liegt er leblos auf dem Lenkrad. Der Beifahrer versucht das Steuer zu übernehmen, doch der tote Kamerad blockiert das Lenkrad und das Gas. Der Wagen fährt auf einen kleinen Felsen zu, von Schüssen begleitet, rast er ins Gestein. Derweil sitzt der Kleine geduckt hinten auf dem Pickup drauf. Seine Hose ist durchnässt. Beim Aufprall kann er sich nicht mehr halten, fliegt aus dem Wagen. Bewaffnete Uniformierte, wie die aus seinem Pickup, stürmen von allen Seiten aus ihren Felsverstecken. Einem Schuss ins Bein folgt ein Schmerz zerreißender Schrei. Das andere Bein wird von oben herab mit zwei Kugeln durchsetzt, der linke Arm und dann der rechte. Ein Bauchschuss folgt. Und in die Berge hallen Echos, doch niemand hört sie. Ein Schuss in den Kopf, löscht nach einer Viertelstunde das letzte Zeichen Lebens des Kleinen. Er war ein tapferer Krieger. Für die Freiheit! Es ist 13.15 Uhr, an einem Mittwoch, dem 02.07.1986.
Man liest es in der Zeitung, man hört es auf der Straße, ein Problem von vielen, doch schlimmer, das andere sieht man 20 Minuten entfernt, ein einsames, hässliches Ärzte-Haus. Die Britin läuft schnell, mit der Welt will sie nichts zu tun haben. Die Welt stinkt. Eine Zeitung flattert langsam an ihr vorbei, sie klappt sich auf und wieder zu. Als wenn sie ganz genau weiß, was sie tut. Tausende verschluckt und wieder ausgespuckt. Die Frau bleibt stehen, zögert kurz und geht dann zum Hintereingang des Hauses. Dorische Säulen, Marmor und große Fenster verzieren es. Fast ein Palast, doch kleiner anzuschauen. Tak, tak, eine Stimme von Innen: «Wer ist es?» – «Der Tod.» – «Ok, komm rein, wir haben dich bereits erwartet.» Eine ältere Dame in einem langen blauen Kleid öffnet die Tür und umarmt die Frau. Ein kurzer Plausch und schon wird sie herein geführt. Die anderen Damen warten schon. Höflich und vornehm begrüßt man sich am großen runden Marmortisch. Das Feuer des Kamins flackert ganz kurz auf. Die Welt ist schlecht, das Leben grau. Alles wie immer, möchte man meinen. Mit ein paar Drinks und bei einer gemütlichen Runde Skat unterhält man sich. «Was macht der Sohn?», «Wann reist du ab?» und natürlich auch «Man muss sich heutzutage vorsehen, wo man hingeht.» Alle stimmen zu. Draußen hat es inzwischen angefangen zu regnen. Erst war es nur ein kleiner Nieselregen, doch inzwischen biegt der Sturm die Bäume. Nein, er tobt nicht, er weiß genau was er tut. Die Frauen nippen an ihren Gläsern und schauen hinaus in den Garten. Ein Baum im Garten fesselt sie. Es donnert und hart, ruckartig, fährt ein Blitz zum Erdboden. Der Baum knickt um und bricht. Wütet dort ein Deutscher? Geschichten kennt man viele. Nach diesem Schreck und der Beruhigung des Regens, scheint es der kleinen Gesellschaft Zeit zum aufbrechen. Jeder geht ins eigene Nest. Vorbei am Schwarzen Viertel. Pfützen bilden sich am Rand, die Türen sind verriegelt, Bretter vorgenagelt. Kein Lüftchen kommt hinein und keins hinaus. Doch man hört etwas. Stimmen die verzweifelt jaulen. Endlich ist sie raus aus dieser Gegend. Schnell rein ins Haus, gemütlich warm, denn draußen fängt es wieder an zu gießen. Sie setzt sich hin, betrachtet «den Schrei», danach ein Bild aus ihrer Heimat. Sie grüßt den Sohn mit Wärme, vielleicht ist es schon zu warm. Der Kamin ist an. Entspannung steigt, doch plötzlich fällt sie rapide. Sie merkt, dass ihr zu warm ist. Die Britin nimmt Abstand vom Kamin. Nur ein paar Meter sind es, doch eisige Kälte folgt. Was sie auch macht, sie setzt sich wieder näher zum Kamin und doch, die Kälte kommt. Sie lässt sie nicht los. Ihr Sohn bringt Schwarzen Tee. Wie Wasser einen Wasserfall, so läuft ihr Schweiß hinunter. Was kann man tun? Die Haut juckt ihr so sehr am Bauch. Sie kratzt sich unentwegt. Zu warm, zu kalt ist ihr. Sie möchte sich wärmer anziehen, betrachtet sich im Spiegel und sieht den eigenen Leib mit Schmerz. Die Haut verfärbt sich, blau und schwarz, aus ihrer Nase läuft der rote Saft des Lebens, die Glieder werden schwach. Sie fällt und nur der Sohn der wacht noch über ihr. 03.07.1919, die Zeit schlägt Mitternacht.
04.07.2007 – Der coole Junge, 18, selbstbewusst. Er wohnt in einer eigenen Mietwohnung, im Zentrum der Stadt. Die neuste Kleidung, Technik, fast kein Problem. Was hat das Leben ohne Technik noch für einen Sinn? Er kennt die Antwort. Ganz lässig läuft er die Straße herunter, die Elefantenhose schleift auf dem Boden lang. Wer Stil hat, hat Geschmack. Sein MP3-Player baumelt am Hals. Er begleitet ihn überall mit hin. Musik im Nirgendwo, was gibt es für eine bessere Erfindung? Noch vor kurzem stand er in diesem Nirgendwo. Eine Leere erfüllte ihn. Er wanderte die Straßen entlang, ließ den Verkehr an sich vorbeiziehen und das Leben Leben sein. Heute ist das anders. 18.30 Uhr, ein Treffen mit Freunden. Er läuft durch die Stadt, geplant, zielorientiert, selbstbewusst. Die S-Bahn trägt ihn schnell weiter. Weg von dem was war. Der Junge setzt sich auf einen freien Platz, gleich am Ausgang muss er sein. Alles rast an ihm vorbei. Nur die Menschen, alle anders, gleich, betrachtet er. Wie ein Hund, er spürt, er riecht, er schnuppert. Seine Kapuze liegt elegant, geplant auf seinem Nacken. Schnüffelnd und doch unauffällig sitzt er dort. Kennt man ihn nicht, dann wüsste man nicht, dass er überhaupt große Regungen, außer seiner durchbohrenden Blicke zeigt. Er muss raus. Zu früh, eine Station zu früh und doch genau richtig steigt er aus. Die Türen der Bahn schließen sich und in zivil Gekleidete lassen verlauten: «Die Fahrkarten bitte.» Nässchen dreh dich, riech und zeig die Offenbarung. Er folgt seiner Nase. Diese Station geht er zu Fuß. Angekommen, endlich unter Gleichgesinnten. Die Wohnung ist besucht, nicht voll, jedoch erträglich. Ein Älterer, vielleicht 20, bittet ihn sich zu setzen. Nach einer freundlichen Umarmung unterhält er sich ganz nett, mal hier, mal da. Zwei sitzen auf einer Couch, nur einer auf dem Balkon. Wortlos reicht er ein Tütchen rüber, wortlos folgt das Geld. Ist etwas passiert? Ich habe nichts gesehen, nur einen Jungen, perspektivlos, arbeitslos, der sich mit Freunden trifft, um über die Ungerechtigkeit dieser Welt zu reden. «Ich muss weiter und morgen wartet noch das Amt auf mich.» hört man ihn sagen. Denn die Wahrheit ist, er hat viele Freunde.
Die Zeit verstreicht, glitzernd weisen die Sterne den Weg. Den Sonnenuntergang werden wir wohl nicht mehr sehen. «Doch vielleicht den Aufgang», flüstert er, sie umarmend. Eine Sternschnuppe erhellt den Hügel. Das Dorf erstrahlt in neuem Glanz. Alltag, Stumpfsinnigkeit, vor sich her leben. Sein und doch schon ein bisschen unter der Erde liegen. Das Gesetz gibt es hier nicht, zumindest jetzt nicht. Der kleine Golf parkt unter einem Baum. Die Zweige und Äste beugen sich schützend über das kleine Gefährt. Das Pärchen sieht dem Schweif hinterher. Ihnen fällt kein Wunsch ein. Sie küssen sich innig und verzweigen sich ineinander, als wären sie eins. Für diesen Moment könnte man meinen, dass sie es sind. Angeschnallt und los geht die Fahrt, doch halt. Den Gurt hat man vergessen. Doch wer braucht schon den Schutz im Paradies? Sie fahren auf der Straße des Lebens. Der Weg ist mit Orangenbäumen versehen. Sie überqueren einen hellblau strahlenden Fluss. Das Wasser plätschert sanft dahin. Die Grünen Hügel und traumhaft schöne Wälder zieren ihren Weg. Sie schweben hoch, miteinander, nur weit weg. Fort von allen Dingen, schweben sie über ihnen und schubsen sie mit Leichtigkeit davon. Wie Blätter vom Wind getragen, verschwinden ihre Sorgen in den Wolken. Verschließen sich, verstecken sich und fahren ohne sie fort. Dem Licht entgegen wandeln sie pausenlos hinab. 05.07., Jahr unbekannt, wie eine unabhängige Tageszeitung berichtet, sind zwei Jugendliche unter Alkoholeinfluss aus der Kleinstadt ohne Namen mit einem Golf geflohen, nachdem sie einen Passanten in der Innenstadt anfuhren. Nach stundenlanger Polizeiverfolgung und nachdem ein Polizist zur radikalsten Methode griff, das Auto mit seiner Waffe zu stoppen, fuhr das Fahrzeug gegen einen Orangenbaum und ging in Flammen auf. Von den Insassen fehlt jede Spur.
Die Tage verfolgen einen. Gerade an diesem wichtigen 06. Juli muss alles richtig laufen. Der Ordner ist aufgearbeitet und steht senkrecht auf dem weißen Schreibtisch. Kein Staubkrümel ist zu sehen. Aus dem sterilen Büro des Towers reicht die Aussicht über die kleine Metropole hinweg bis an die Berge und an das Meer heran. Zwei Minuten Entspannung. Es klopft und zwei Männer in schwarzen Anzügen, hellblauen Hemden und orangefarbener Krawatte treten ein. Die neuste Modewelle macht hier jeder mit. «Angenehme Kühle füllt den Raum», bemerkt der Linke. «Für meinen Geschmack zu kühl», antwortet der Rechte. Er bietet ihnen einen Drink und Stuhl an und bemerkt, dass dies die neuste Klimaanlage sei, der Cooler 241. «Soll ich ihn abstellen oder anlassen? Wie hätten Sie es gerne?» – Keine Antwort, die Kälte bleibt. Es herrscht Bewegung im Kreisverkehr. Die Autos fahren im Kreis, immer wieder andere, doch die Insassen verändern sich kaum. Plötzlich gibt es einen Crash. Ein Auto ist zu dicht aufgefahren, zu schnell in den Verkehr gerast. Ein weiteres und noch ein anderes fährt rein. Der Dominoeffekt tritt ein und bald ist der ganze Kreis voll. Es staut sich. Zu Hause angekommen, in seiner Einzimmer-Wohnung begrüßt er den schwarzen Hund, geht in die Küche, kippt sich etwas Farbloses ein und bewegt sich müde Richtung Couch. Ein Tag ist zu Ende und doch ist er nicht wie jeder andere. Ein Glas, ein zweites und ein drittes folgen. Der Angestellte nimmt das Telefon, man hört ihn einen Termin bestätigen und geht. Ein Transporter fährt vor die Haustür des kleinen Fünfgeschossers. Arbeiter tragen die Möbel fort und übrig bleibt Leere und nichts als sie in Raum und Zeit.
Wer bin ich? Was mache ich hier? Wo hört die Welt auf? Warum gibt es so viele Kriege auf der Welt? Gott, gibt es dich? Warum ist der Mensch so selbstzentriert? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Die Vögel beschallen den Wald, der Fluss plätschert vor sich hin. Standhaft bewachen die Backsteinhäuser sich selbst. Ein Auto fährt ganz gemütlich über die Brücke am Fluss, Kinderstimmen, Lachen. Jede Sekunde stirbt ein Mensch an Hunger oder Aids. Kinder werden entführt. Kriege, Seuchen, Unfälle und all das kann ich nicht verhindern. Ich habe es erschaffen und versagt, es zu bekämpfen. Ein weißes Licht steigt hinab. Der Boden des Gebirges spaltet sich, berstet entzwei. Ein Krater aus Feuer, Lava und dem Gestank des Todes weht dem blendenden Licht ohne Namen entgegen. Ein alter Mann steigt empor. Sein Hut ist vom Feuer leicht geröstet. Er gleitet hinab auf einen Steinvorsprung am Rande der Kluft. Der Mann zieht mit viel Kraft einen Gegenstand aus der Hüftgegend. Fast so hell wie das Licht, doch leicht getrübt wie ein milchiges Glas. Ein Blick reicht nicht, um zu erkennen, was er in seiner Hand hält. Auch ich musste mehrmals hingucken, bis ich hinter dem milchig blendenden Licht den Mann wieder erkannte. In seiner Hand hält er ein silbernes Schwert. Er berührt die Klinge sanft mit der anderen Hand, hält beide Arme vor sich und kniet nieder. Er schreit ins Licht, gen Himmel: «Nimm dieses Schwert und richte, entgehe allem Schlechten! Du kannst es nicht kontrollieren! Nimm es, und werde eins mit der Natur!» Das Licht flackert langsam, fast bedenklich und eine Stimme hallt heraus: «Doch wer soll die Probleme lösen, wenn nicht ich selber?» Die Lava brodelt, schnellt hoch, doch kann das Licht nicht erreichen. «Probleme? Du löst sie nicht, du hast sie geschaffen. Umso mehr du dich bemühst, umso größer wird das Unheil!», schreit der Alte. Er hebt das Schwert und ruft aus der Hitze der Erde hinaus: «Sieh her, ich mache es dir vor, denn ich bin ebenso nichts Wert.» Er setzt das Silberwerkzeug an, erhebt es und sticht zu. Ein Röcheln folgt, das Blut fließt langsam von dem Felsen. Es fließt herab, will in der Lava zergehen. Doch diese wird so gleich zu Stein. Ist er wirklich nichts wert? Kann er nichts erreichen? Er hat es bis heute nicht geschafft etwas zu verbessern. Was sollte sich nun ändern? Er geht zum Mann, er fühlt den Puls und kann kein Zeichen von Leben erkennen. Er nimmt das Schwert, und schwebend trifft es ihn, zerschneidet das Licht, von links nach rechts, von oben nach unten. Es löst sich langsam auf, in einzelne Splitter, die immer kleiner werden, und noch ein letztes Mal sieht er den alten Mann, bevor sich Dunkelheit ergießt. Er zwinkert. 07.07.2007
Letzte Einträge
Themen-Thermometer
- André-Preidel Astrid-Hoff Bernd-Mayer Blog Blogosphäre Christian-Lumma Daniel-Thiem Die-Linie-7 Die-sieben-Zwerge-von-G47 Dominik-Opalka Duisburg Flyer Franziska-Ring Hans-Joachim-Heider Info Information Jury Kellapage Kurzgeschichte Kurzgeschichten Lavendel Lyrik-Forum MP3 Nora-Lessing OpenPR PDF Philosophie-Raum Presse Promotion Prospero Remscheid Robin-Haseler Sajonara Sieben Sieben-Himmel Siebenschläfer Teddykrieger teilt-euch-mit-uns Thomas-Zelejewski Turnschuhromantik Uta-Brandschwei Verlag Wettbewerb Wordpress Zu-Risiken-und-Nebenwirkungen

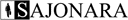
Nov 26th, 2007 at 6:25 pm
Leider kam meine Geschichte nicht unter die 41 Geschichten, die “den Sprung geschafft” haben. Dennoch oder vielleicht auch gerade deshalb bin ich natuerlich fuer jede konstruktive Kritik offen und freue mich auf einen offenen Meinungsaustausch, auch von Seiten der Jury.