von Daniel Thiem
Dunkel und kalt ist es da oben und leer, leerer. Nur ein paar kleine, goldene Brocken sind übrig – doch auch die werden bald verbraucht sein.
Es begann grob, Spitzhacken trieben Risse in den Stein, dann wurde der Schutt zerkleinert, gewaschen. Am Schluss blieb jedoch die Verantwortung an ihm hängen. Er hatte Augen wie ein Falke – selbst ein noch so unscheinbares Schimmern im trüben Schlamm entging ihm nicht.
Zwanzig Jahre lang saßen wir abends gemeinsam im Busch und zwanzig Jahre lang waren wir hungrig: nach einem schönen Haus, nach einem schnellen Auto, nach einer hübschen Frau und vielleicht auch nach Kindern, die uns brauchten. Denn niemand brauchte uns wirklich. Die Kompanie missbrauchte unsere Körper, der schmutzige Alltag beraubte uns mit der Zeit all unserer kärglichen Perspektiven, vertrieb die großen Träume – und mit ihnen unseren wachen Verstand. Aber abends, am Lagerfeuer, wenn wir uns Mut machten, da glühten seine Augen, seine Falken-Augen. Er erzählte von seiner Jugendliebe, die er heiraten wollte, von seinem Heimatdorf, in das er zurückkehren würde, wenn er erst gefunden habe, wonach er all die Jahre suchte. Doch was er fand, waren immerzu nur Krümmel, selbst die winzigsten entdeckte er zwar, aber eben immer nur Krümel.
Manchmal fuhren wir in die ferne Stadt, wenn wir unseren Anteil an einem etwas größeren Krümel ausbezahlt bekommen hatten, ließen uns sodann volllaufen, von unansehnlichen Prostituierten ausrauben und kehrten niedergeschlagen zurück. So ging das ein ums andere Mal.
Wir lernten mit der Zeit halbes Benzin zu trinken. Unsere Lagerfeuer wurden immer trauriger. Dumpf und höhnisch klangen nun seine Juwelen, er klammerte sich an etwas fest, von dem er wusste, dass es verpasst und unwiederbringlich vergangen war. Und zerbrach er innerlich, so äußerte sich sein ununterbrochener Alkoholmissbrauch dadurch, dass er im Alltag immer weniger zurecht kam. Er konnte sich bald nicht mehr eigenständig kleiden, ernähren, er konnte sich nicht mehr verständigen. Die anderen und ich halfen ihm, so gut es ging, doch es wurde immer schlimmer, von Tag zu Tag.
Seine Lippen formen Worte in einer wimmernden Phantasiesprache, die Spucke läuft wie Harz aus einem verletzten Baumstamm; doch verkrampft halten seine Hände noch immer das Sieb, reißen es zitternd hin und her, dünne Zweige im Sturm. Am Abend, wenn wir aus der Mine steigen, liegt neben seinem Platz stets ein kleiner Haufen matt glänzender Krümel. Haben wir ihn dann mit zu uns ans Feuer getragen, lächelt er entrückt, wiegt seinen Oberkörper sanft und murmelt dabei leise Silben. Es klingt wie “Juanita”.
Letzte Einträge
Themen-Thermometer
- André-Preidel Astrid-Hoff Bernd-Mayer Blog Blogosphäre Christian-Lumma Daniel-Thiem Die-Linie-7 Die-sieben-Zwerge-von-G47 Dominik-Opalka Duisburg Flyer Franziska-Ring Hans-Joachim-Heider Info Information Jury Kellapage Kurzgeschichte Kurzgeschichten Lavendel Lyrik-Forum MP3 Nora-Lessing OpenPR PDF Philosophie-Raum Presse Promotion Prospero Remscheid Robin-Haseler Sajonara Sieben Sieben-Himmel Siebenschläfer Teddykrieger teilt-euch-mit-uns Thomas-Zelejewski Turnschuhromantik Uta-Brandschwei Verlag Wettbewerb Wordpress Zu-Risiken-und-Nebenwirkungen

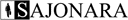
Apr 20th, 2007 at 4:09 am
Ah, -sieben-! Zwei, drei Sekunden hat´s gedauert… Dann dämmert´s.
Schön geschrieben