von Petra Kroner
Die meisten Menschen verbinden mit der Zahl 13 Unglück und schlimme Ereignisse. Ich hingegen habe die gleichen negativen Vorstellungen und Emotionen mit der Ziffer 7. Diese Unglückszahl verfolgte mich von Anfang an und haftet an mir wie klebriges Pech. Es begann schon damit, dass ich am 7. Tag des 7. Monats geboren wurde.
Niemand fragte mich zuvor, ob ich Lust hatte, auf diese kalte, unerfreuliche Welt zu kommen und ob ich gewillt war, als 7. Kind in dieser meiner zukünftigen Familie zu leben. Entsprechend schwer war meine Geburt, da ich mich heftig dagegen sträubte, ins Elend katapultiert zu werden. Es nützte nichts, dank unserer tüchtigen, kampferprobten Hebamme wurde ich ins Leben gezerrt und hörte als erstes die raue Stimme meines Vaters: „Schon wieder eine Tochter! Nr. 7! Na dann Prost Mahlzeit! Deine Bälger werden auch immer mickriger. Die ist ja nur Haut und Knochen und dazu noch rothaarig.”
Er verschwand für mehrere Stunden und kam erst in der Nacht sturzbetrunken nach Hause. Auf das Gekeife meiner Mutter brummte er nur: „Man wird doch noch dieses großartige Ereignis feiern dürfen.”
Mein Erzeuger brachte es nicht so recht über sich, mich im Laufe der Jahre mit dem richtigen Namen anzureden. „Wie kann man ein Kind nur Priscilla nennen? Alte, Du spinnst! Warum hast Du sie nicht Anna nach meiner Mutter genannt?” So vernahmen meine Ohren nur: „Nr. 7, bring mir ein Bier!” Bei den alten Römern, die ihre Kinder häufig durchnummerierten, man denke nur an Kaiser Augustus (= der Achte), hätte ich Septima, die Siebte, geheißen. Ich bedauerte allerdings, dass mein Vater kein edler Senator, sondern ein unverbesserlicher Säufer war.
Wir wohnten damals in einer schmierigen Bruchbude am Bahnhof. Vermutlich brauche ich Ihnen nicht zu sagen, dass wir die Hausnummer 7 hatten. Das Schild war zwar kaum noch zu erkennen, aber wir bekamen ohnehin keine Post. Seine Arbeitslosenunterstützung und das Kindergeld holte unser Haushaltsvorstand auf dem Weg zu seiner Stammkneipe ohnehin persönlich ab. „Man kann ja niemandem mehr trauen”, pflegte er zu philosophieren. „Die Menschheit wird immer schlechter.”
Meine Mutter hielt uns mit Putzen über Wasser. Die meiste Zeit verbrachten wir also auf der Straße und lernten ruck, zuck, was der Mensch zum Überleben braucht. Obwohl ich nach wie vor dünn und inzwischen auch hoch aufgeschossen war, konnte ich boxen wie ein Profi, treten wie ein Maulesel, spucken wie ein Lama, kratzen wie eine in die Enge getriebene Katze und beißen wie ein Bullterrier. Ich war weit und breit gefürchtet, denn mein Zorn auf die besser gestellten Nachbarkinder, war echt und gnadenlos. Ein Aufatmen ging durch unser Viertel, als ich endlich eine Leerstelle bekam und meine Kraft und Energie ein anderes Ventil fanden.
Da mein Zeugnis eine Katastrophe war, wollte niemand mich nehmen. Nur ein Händler, bei dem meine Mom putzte, erbarmte sich ihrer und meiner und erlebte eine angenehme Überraschung, da ich meine Sache recht ordentlich machte.
Anfangs war mein Chef gar nicht so übel, obwohl er sich als ziemlicher Dummschwätzer entpuppte. Als er aber im Laufe der Zeit seinen Worten auch Taten folgen ließ und anfing, meinen allmählich fraulich werdenden Körper zu betatschen, war Wachsamkeit angesagt. Wie ein brünstiger Hirsch trampelte er ständig hinter mir her und versuchte, mich in dunklen Ecken in die Enge zu treiben. In einer mehrstöckigen Lagerhalle, in die der fiese Lustmolch mich mit einem Auftrag geschickt hatte, stand er mir plötzlich gegenüber, mit dem Rücken zur offenen Transporttüre.
Seine gierigen Hände hatten mich kaum berührt, als ich routiniert das Trainingsprogramm, mit dem ich mich schon seit langem auf diesen Augenblick vorbereitet hatte, abspulte. Mein Knie traf seinen Unterleib und die Fäuste den nach vorne kippenden Oberkörper. Mit fassungslosem Gesichtsausdruck und einem erstaunten „Aber Fräulein Priscilla . . . !” fiel der alte Grabscher nach hinten durch die Luke und nahm den Weg, der sonst ausschließlich den vom Kran nach unten transportierten Waren vorbehalten war, nur wesentlich schneller. Ein Sturz vom 7. Stock ist selten erfreulich. So auch hier. Meine Mutter sah sich gezwungen, eine neue Putzstelle zu suchen, und ich beendete nach 7 Monaten mein Azubi-Dasein und jobbte in einem Lokal. Niemand brachte mich mit dem Todesfall in Verbindung.
Zu Hause interessierte sich keiner für die Angelegenheit. Tot war tot, und meinem Vater war es ohnehin egal, ob er mein Lehrlingsgehalt oder mein Kellnerinnentrinkgeld versoff. Er wurde immer schlimmer und brutaler. Ständig bedrängte er meine Mutter, noch mehr von ihren sauer verdienten Moneten herauszurücken und prügelte sie quer durch die Wohnung, wenn das arme Ding versuchte, wenigstens ein paar Piepen für Lebensmittel und Miete zurückzuhalten.
Da ich mich gezielt und geplant gegen meinen ehemaligen Arbeitgeber gewehrt hatte, war mir auch jetzt klar, ich musste handeln. Deshalb erhöhte ich die Dosis seiner Herztropfen so lange, bis mein Vater eines Morgens die Augen nicht mehr öffnete. Der Hausarzt, den es beim Betreten unserer vier Wände jedes Mal unmerklich leicht schüttelte, achtete sorgfältig darauf, mit seinen gepflegten Händen nichts zu berühren. In einer Geschwindigkeit, als sei der Teufel hinter ihm her, stellte er den Totenschein aus und verschwand so schnell, wie er gekommen war.
Zu meiner Überraschung führte Mama keinen Freudentanz auf, sondern brach in Tränen aus und teilte uns und der hinzugekommenen Nachbarschaft mit, sie wisse nicht, wie sie mit diesem großen Verlust weiterleben sollte. „Er war ein herzensguter Mensch”, schluchzte die frisch Verwitwete, „ ein wunderbarer Vater und Ehemann, der gut für uns sorgte.” Mir blieb die Spucke weg. „Hatte ich vielleicht irgendetwas nicht mitbekommen oder gab es noch einen Dad, von dem ich nichts wusste?” Ich jedenfalls war froh, den alten Saufsack los zu sein. Sieben Wochen später zog Ricardo bei uns ein, ein Gastarbeiter, der allmählich zum Gastfaulenzer wurde. Wie eine Made im Speck ließ sich Moms Lover aushalten und ekelte uns Kinder der Reihe nach aus dem Haus.
Mir war inzwischen alles schnurz egal. Ich hatte mich verliebt und schwebte auf rosa Wölkchen. Zwar konnte mich die Mutter meines neuen Freundes nicht ausstehen, da sie die Ansicht vertrat, so etwas wie mich gäbe es an jeder Straßenecke. Wir ließen uns jedoch nicht abschrecken. So war sie nicht in der Lage zu verhindern, dass wir zusammenzogen, und zwar in ihr Haus. Da Madame hinfällig war und Hilfe im Alltag brauchte, machte sie aus der Not eine Tugend und spielte mit großem Talent die Rolle einer Sklaventreiberin. 24 Stunden am Tag ließ sie sich von vorne bis hinten bedienen, kritisierte alles und jedes und verspritzte pausenlos ihr Gift.
Nach 7 Monaten wusste ich, es musste etwas geschehen. So konnte es nicht weitergehen. Eine kleine Manipulation ihrer Tabletten brachte die alte Hexe auf saubere und stresslose Art für immer zum Schweigen. Nr. 3 in meinem Leben hatte den Löffel abgegeben.
Da bekanntlich nichts ewig währt, begann mir mein Schatz nach einiger Zeit trauter Gemeinsamkeit mächtig auf den Keks zu gehen. Das ständige Händchenhalten auf dem durchgesessenen Sofa, während die Sportschau lief, seine ewig gleichen dümmlichen Kommentare, die höhepunktslosen Wochenenden vermittelten mir das Gefühl, bereits zu den Toten zu gehören. Während er sich noch in vermeintlicher Harmonie suhlte, war mir klar: „Priscilla, es ist an der Zeit, die Tapeten und den Mann zu wechseln, bevor Aggressionen dich überkommen und du die Kaffeekanne, das gute Stück, das nur sonntags zum Einsatz gebracht werden darf, entgegen der Benutzungsregel zweckentfremdest und in die Scheiben der Vitrine wirfst.”
Im neuen Szene-Lokal “The Seven Beauties”, das von 7 atemberaubend schönen, samtäugigen Negerinnen geführt wurde, hingen die Supertiere Löwe, Elefant, Zebra, Büffel und Nashorn, die der Afrikareisende unbedingt gesehen haben muss, in diversen Variationen an den Wänden, angefangen von Bildern über Felle und Stoßzähne bis hin zu präparierten Köpfen. Alles war toll afrikanisch aufgemotzt, unterstützt von Waffen, Masken, Figuren und gewebten Tüchern. Im Hintergrund liefen Videos, und eine Live-Band rundete das Bild ab.
Dieses Ambiente schien der passende Rahmen für Möchtegern-Großwildjäger zu sein. Erst dachte ich, dass ich im Aufenthaltsraum eines Senioren-Clubs stünde, da nur alte Knaben die Bar bevölkerten und sich an junge knackige Beute heranschlichen. Männer müssen sehr reich sein, wenn sie unter o.g. Umständen meine Gnade finden. Eine Bekannte flüsterte mir zu: „Die Knacker hier sind nahezu ausnahmslos millionenschwer.”
Nachdem ich mich seit meiner Geburt nur im Kreise von Versagern und Schmarotzern aufhalte, schien mir die Zeit reif, endlich einmal die Gewinnerseite kennenzulernen. Es hätte mich warnen müssen, dass meine Neueroberung neben den üblichen Statussymbolen ausgerechnet siebenfacher Millionär war. Er war galant und nicht kleinlich, besaß Häuser, Wohnungen, Autos und – niemand ist perfekt – auch eine wesentlich ältere Ehefrau und eine dazu passende Schwiegermutter, die mit in seinem Haushalt wohnte. Diesen beiden Grazien verdankte er nicht nur seine Depressionen, sondern auch den ganzen Wohlstand.
Trotzdem zog ich in seine Penthauswohnung in der Stadt und ließ es mir erst einmal gut gehen. Ich brauche sicher nicht zu erwähnen, dass ich meinen Karl-August nicht nur glücklich, sondern auch zum „doppelten” Witwer machte. Ich schubste die gnädige Frau und ihr Mütterchen vor einen Bus, als sie wie jeden Dienstag in der Stadt weilten und auf dem Wege zu ihrer Kosmetikerin waren. Meinem Liebsten ersparte ich damit eine Menge Geld. „Stellen Sie sich doch einmal vor, jeden Dienstag und das über Jahre!” So wackelig, wie sich die zwei Ladys auf ihren Beinen bewegten, erschien es mir wie ein Kinderspiel, und Nr. 4 und Nr. 5 hauchten ihr überflüssiges Leben aus. Ich glaube nicht, dass sie sehr gelitten haben.
Aus dem trauernden Witwer wurde bald wieder ein lebensfroher Ehemann, nur mit ausgetauschter Dame. Es gefiel mir, reich zu sein, nicht mehr arbeiten zu müssen und mir lang gehegte Wünsche zu erfüllen. Für kurze Zeit war ich wunschlos glücklich, d.h. fast wunschlos glücklich. Mich störte allerdings sein ewig sabbernder Boxer, der seine Kuschelecke in unserem gemeinsamen Schlafzimmer vehement verteidigte, mich trotz diverser Bestechungsversuchen mit Wurstzipfeln und Leckerchen einfach nicht leiden konnte und deshalb regelmäßig in meine Designerschuhe pinkelte.
Nr. 6 war schnell erledigt. Ich ließ das prachtvolle Eingangstor zu unserem Anwesen offen und rechnete mit der natürlichen Neugierde von Mr. Dog. Und richtig! Wenige Stunden später standen Polizisten auf der Matte, ein Hundehalsband mit Plakette in der Hand und teilten uns das Ableben der alten Sabberbacke mit, die den Zusammenstoß mit dem 14.22 Uhr-Eilzug, auf den nahe gelegenen Gleisen nicht überlebt hatte.
Wir alle trauerten sehr, besonders aber unser Gärtner, weil ihm unterstellt wurde, das Tor zur tödlichen Freiheit nicht ordnungsgemäß verschlossen zu haben, was seinen Rausschmiss zur Folge hatte.
Friede war eingekehrt. Der Haken bei der Sache war nur, dass mir nach wenigen Monaten, sie erraten sicher, dass es sieben Monate waren, mein triefäugiger, tränensackiger, wohlbeleibter, betulicher Partner furchtbar peinlich wurde. Die Bemerkung der Tochter eines Bekannten: „Ist das Dein Opa?” gab mir den Rest. Ich war zum siebten Male in meinem jungen Leben entschlossen, dem Schicksal einen Tritt in den Hintern zu geben.
Ich brauchte meine Fantasie nicht allzu sehr anzustrengen. Eine der Macken meines Herzallerliebsten spielte mir förmlich in die Hände. Immer wenn der Herbst nahte und die Luft feucht und nebelig wurde, begann er mit den Hufen zu scharren, einen Korb aus dem Keller zu holen und ab ging’s in der frühen Dämmerung „in die Pilze oder in die Schwammerl”, wie er neckisch sagte.
Obwohl jeder Trottel weiß, in den Supermärkten quellen die Regale über von Pilzen feinster Qualität, ließ Karl-August es sich nicht nehmen, selbst Hand an die armen wehrlosen Waldchampignons, Pfifferlinge, Maronenröhrlinge und Steinpilze zu legen, oder wie sie alle heißen mögen. Erfreulicherweise bereitete er sie sogar selbst zu. „Da lass ich keine Frau dran. Sie dürfen nur zart gedünstet werden, sonst verlieren sie an Geschmack”, tönte mein Naturbursche. Während er sich schmatzend und selbstzufrieden über sein Schüsselchen beugte und ich mir ein Käsebrot gönnte, ermunterte ich ihn zu einer weiteren Pilzaktion. Im Gefrierfach lagerten wundervolle Köstlichkeiten wie Grüner Knollenblätterpilz, Pantherwulstling und Feld-Trichterling, die darauf warteten, bei der nächsten Gelegenheit rasch unter seine Pilz-Zwiebelpfanne gemengt zu werden. Bei der ersten und einzigen Pilzwanderung in dieser Saison, zu der ich mich hatte erweichen lassen, war ich eine gelehrige Schülerin gewesen.
Der Tod ereilte meinen armen Ehemann in den frühen Morgenstunden, nachdem er vergeblich versucht hatte, nach einem unbekömmlichen Pilzgericht den ärztlichen Notdienst zu erreichen. Wie das Leben so spielt, waren zu diesem Zeitpunkt in unserer einsamen Berghütte alle Telefone außer Betrieb, Handy und Autoschlüssel unauffindbar und die im Nebenzimmer ruhende Ehefrau indisponiert, da sie eine Schlaftablette genommen hatte.
Als der herbeigerufene Arzt die Todeszeit auf circa 7 Uhr morgens festlegte und mich so seltsam ansah, schwante mir Schlimmes. Misstrauisch informierte er die Polizei. Untersuchungen brachten winzige Spuren giftiger Pilze in der Gefriertruhe und im Abfalleimer zu Tage.
Seit 7 Wochen sitze ich in Untersuchungshaft und, wie mein Verteidiger meint, sieht es gar nicht gut aus. „Ich wusste es immer! Die verflixte Sieben ist meine Unglückszahl!”
Letzte Einträge
Themen-Thermometer
- André-Preidel Astrid-Hoff Bernd-Mayer Blog Blogosphäre Christian-Lumma Daniel-Thiem Die-Linie-7 Die-sieben-Zwerge-von-G47 Dominik-Opalka Duisburg Flyer Franziska-Ring Hans-Joachim-Heider Info Information Jury Kellapage Kurzgeschichte Kurzgeschichten Lavendel Lyrik-Forum MP3 Nora-Lessing OpenPR PDF Philosophie-Raum Presse Promotion Prospero Remscheid Robin-Haseler Sajonara Sieben Sieben-Himmel Siebenschläfer Teddykrieger teilt-euch-mit-uns Thomas-Zelejewski Turnschuhromantik Uta-Brandschwei Verlag Wettbewerb Wordpress Zu-Risiken-und-Nebenwirkungen

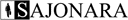
No Comments
Leave a Comment
trackback address
You must log in to post a comment.